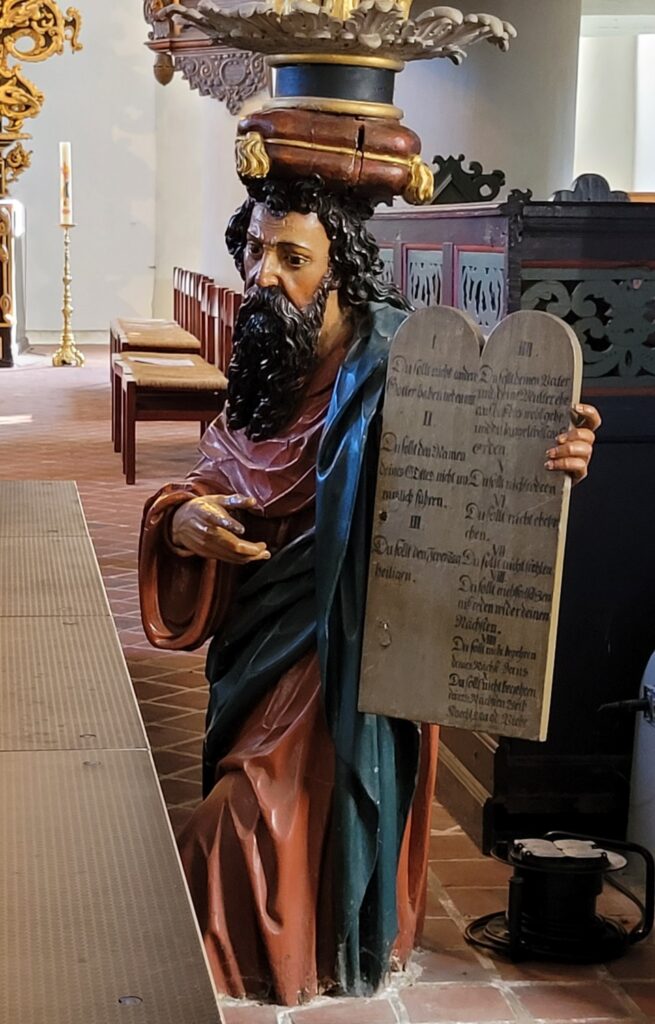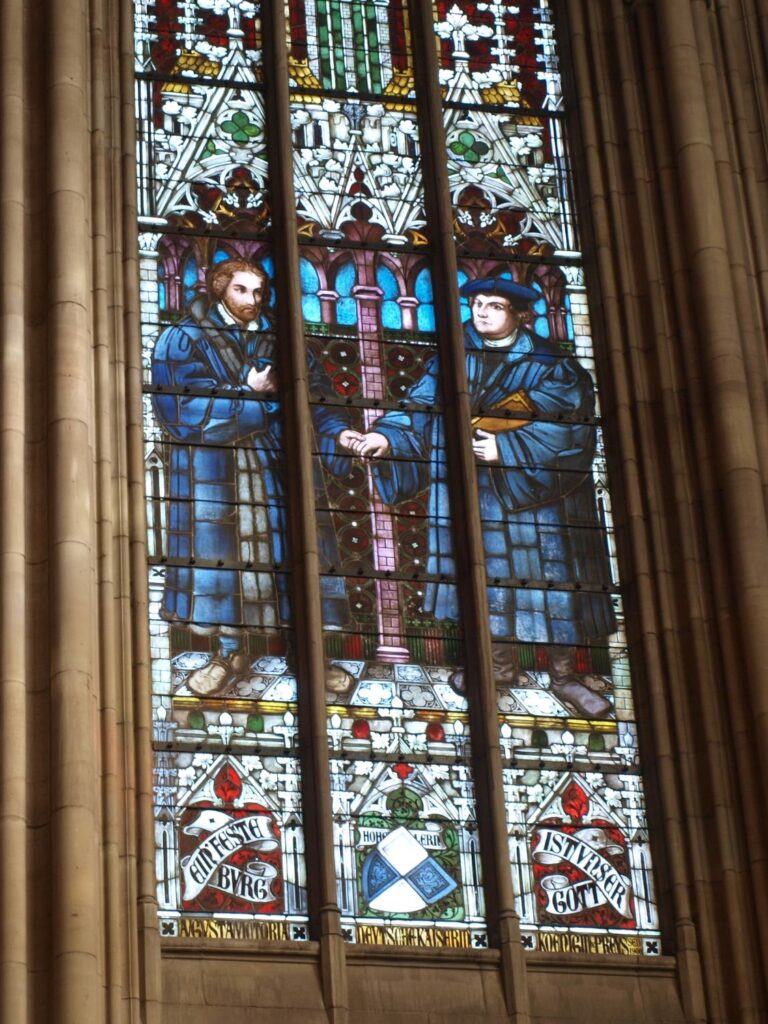„Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und Gemeinden in Wuppertal“
Zur Geschichte der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und Gemeinden in Wuppertal“ (ACKuG)
– Die Anfänge und die Erfolge –
Festvortrag beim Empfang zum 50jährigen Jubiläum
am 10. Juni 2022 in der Ev. Citykirche Wuppertal
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schneidewind, liebe Frau Federschmidt, lieber Herr Kurth, sehr geehrter Herr Abodahab, lieber Michael, liebe Gäste, liebe Delegierte!
1.
Stellen Sie sich bitte vor, wie alt Sie im Gründungsjahr der ACKuG 1970 waren.
Sollten Sie 1970 noch nicht geboren gewesen sein? (Gibt es das in kirchlichen Kreisen?) Dann stellen Sie sich als Kind oder als Jugendlicher vor. –
Zu welcher Kirchengemeinde oder zu welcher religiösen Gemeinschaft gehörten Sie damals?
Und wie haben Sie damals andere, benachbarte Gemeinden und Gemeinschaften, Christenmenschen anderer Konfession wahrgenommen ?
Ich war 15 im Jahr 1970. Als Kind und Jugendlicher habe ich in einer kirchlich wohlgeordneten Welt gelebt – friedlich – aber schiedlich. Wir waren „die Reformierten“, andere „die Lutheraner“, „die Katholiken“, „die freien Gemeinden“.
Die kirchliche Welt war wohlgeordnet – und damit durchaus spannend. Wir hatten manche Dinge nicht, die andere hatten: kein Kruzifix, nicht einmal ein Kreuz, keine Kerzen, keine Antependien, keine Responsorien. Diese Ausdrücke kannte ich damals aber noch nicht. Anderes ersetzte, was andere hatten: ein Tisch den Altar, das Mätensingen den Martinszug. Und Erkenntnisse über die anderen sammelte ich vor allem am Buß- und Bettag. In einem Jahr ging man in die Freie evangelische Gemeinde, in einem anderen in die katholische Kirche, in einem dritten in die Lutherkirche und im vierten in die eigene. –
Wie war es bei Ihnen?
Haben Sie die Konfessionen 1970 eher im Miteinander oder doch eher im Gegeneinander oder eigentlich nur – so wie ich – als nebeneinander existierend empfunden?
2.
Wenn man im Archiv des evangelischen Kirchenkreises in die Unterlagen der Gründungsphase der ACKuG um 1970 schaut, tut sich eine vollkommen andere ökumenische Welt auf, als ich sie damals empfunden habe. Hier waren – weitgehend – Männer am Werk, die, obwohl konfessionell geschieden, gemeinsam ihren Glauben leben wollten.
Es ist in den nüchternen Schriftstücken, Protokollen und Schreiben zu spüren, wie sie gewillt waren, miteinander zu arbeiten, wie sie dem Mitbruder und der Mitschwester den ihm bzw. den ihr eigenen Glauben zugestehen, wie sie sich im sozialen Engagement treffen, wie sie die gemeinsame Liturgie suchen. Ja, mein Eindruck bei der Durchsicht war, dass sie sich mochten, auch wenn das nirgends zu lesen ist.
War es sogar ein gewisses Erleiden der Unterschiede? Sie wussten, sie können noch nicht zusammen Kirche Jesu Christi sein. Sie wussten, sie leben in unterschiedlichen Kirchen, in unterschiedlichen Traditionen, in unterschiedlichen geistlichen Sozialisationen. Sie spürten, aus solchen kann niemand einfach schnell hinausschlüpfen. Die Prägungen sitzen tief. Vieles an Erkenntnis, an Gewohntem würde auch keine/r aufgeben; sie waren ihnen zu lieb.
Aber im Grundsatz waren sie sich einig. Wir müssen uns noch besser kennenlernen. Und vor allem: wir wollen gemeinsam das christliche Leben in Wuppertal gestalten. Miteinander. Nicht gegeneinander, nicht in Abgrenzung.
Und der Plural meint hier nicht nur ein paar Willige, sondern auch die Leitungen der Kirchen auf der städtischen Ebene. Natürlich gab es Fragen und Bedenken. Natürlich schoben die beiden sog. „großen Kirchen“ einer allzu großen Hoffnung auf gemeinsames Entscheiden einen Riegel vor, was den Freien aber durchaus recht war.
Doch alle wollten und förderten sehr aktiv das Zustandekommen der Arbeitsgemeinschaft. Sie achteten fair auf Parität und Ausgewogenheit, zankten sich nicht um Wörter, sondern hier fand sich, so der Eindruck, eine „Einmütigkeit“ vor allem im gemeinsamen Willen.
Und sie stellten sich stark auf: Die Konfessionen delegierten ihre am stärksten ökumenisch gesinnten Leute, die, die auch in den bereits bestehenden Ökumenischen Arbeitskreisen die Arbeit vorantrieben. Ein aus meiner Sicht eher konservativer Superintendent Höhler machte sich stark, Funktionsträger wie z.B. den Jugendreferenten zu delegieren, um Fachkompetenz einzubringen oder wies die Theologen an, für die ACK-Veranstaltungen zu werben. Ökumene als echtes Anliegen, weder als Anhängsel, modisches Lippenbekenntis noch als lästige Pflichterfüllung,
3.
Es ist klar, welche Generation hier am Werk war, eine, die es besser machen wollte, die gelernt haben wollte aus der Vergangenheit: aus dem Scheitern an Zeugnis und Dienst, aus dem Versagen gegenüber der vernichtenden Ideologie. Die Akteure eben auch in Wuppertal waren bewegt von den Erfahrungen der Kriegszeit.
„Die Kriegszeit „hat das Bewusstsein eines gefährdeten gemeinsamen Erbes den römisch-katholisch-protestantischen Beziehungen in vielen Ländern eine Tiefe der Verbundenheit im christlichen Zeugnis geschenkt, wie es sie nie zuvor gegeben hat.“ In ganz Europa „haben römische Katholiken und Protestanten miteinander gelitten und sind miteinander in Gefängnissen und Konzentrationslagern gestorben …“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_%C3%96kumene )
Wir wissen, dass die konfessionelle Orientierung unter den Umständen etwa eines KZs oder an der Front keine wirkliche Bedeutung entfaltete, auch wenn die Einzelnen natürlich sie beheimatende religiöse Praktiken versuchten, unter den gegebenen Umständen so gut es ging zu leben.
Mann kann aber sicher sagen, dass wir die heutige Ökumene – in ihrer ganzen Tiefe – der Erkenntnis verdanken, dass der Krieg gezeigt hatte, dass die Gemeinsamkeit des Christusbekenntnisses das Tragende des Glaubens gewesen war – für alle.
Der Krieg und seine Verwerfungen gehörten zum Erlebnishorizont der Hauptakteure bei der Gründung der ACKuG. Sie kamen sicher wie wie auch viele unter uns aus einer lebendigen Gemeindearbeit. Aber sie hatten eine Erfahrung, die wir Heutigen angesichts des Krieges in der Ukraine allenfalls erahnen können.
Superintendent Heinrich Höhler (Elberfeld) war Jahrgang 1908. Er verstarb 1995. Von 1938 bis 1972 war er Gemeindepfarrer in der Reformierten Gemeinde Elberfeld und von 1954-1972 Superintendent des Kirchenkreises Elberfeld. Er hatte sogar den Ersten Weltkrieg schon bewusst erlebt.
Superintendent Hans Mehrhoff (Barmen) war Jahrgang 1911. Er verstarb 1983. 1936 wurde er Hilfsprediger der Bekennenden Kirche in Barmen-Gemarke, ab 01.04.1936 oblag ihm für neun Jahre vertretungsweise die Verwaltung des 2. Bezirks der Gemeinde. Ab Juni 1945 war er dann „legal“ Pfarrer von Gemarke und 1958-1972 Superintendent des Kirchenkreises Barmen.
Wilhelm Flender, unermüdlicher Förderer der Ökumene, war ebenfalls Jahrgang 1911 und verstarb 2000. Er spielte für den Kirchenkreis Barmen bei der Gründung der ACKuG die zentrale Rolle. Von ihm stammen die meisten Unterlagen der Gründungszeit im Archiv des evangelischen Kirchenkreises. Ihm gilt ein besonderes Innehalten, wenn wir die Geschichte der ACKuG betrachten. Von 1962-1976 war er Gemeindepfarrer in Unterbarmen. Als Gründungsvater der ACKuG wurde er in der Sitzung am 8. Mai 1994 verabschiedet. Er war kriegsbedingt auf Sumatra interniert gewesen, wo er von 1938-40 Missionar war, später auch theologischer Lehrer.
Dechant Prälat Paul Hanisch war Jahrgang 1912. Er verstarb 1987. Er war zweifelsohne eine ganz besondere Persönlichkeit, als die er auch über Wuppertal hinaus wahrgenommen wurde. Heute erinnert das Caritas-Altenzentrum Paul-Hanisch-Haus an ihn. Er ist auch Träger des Ehrenrings der Stadt Wuppertal (1976). Er war der Entscheidende Mann auf der katholischen Seite.
Andere wichtige Akteure 1970 bei Gründung der ACKuG waren jünger. Sie waren Menschen, die den Krieg als Kinder bzw. als Jugendliche erlebt hatten.
Siegfried Meurer war Jahrgang 1931 und verstarb 2001. 1962-1971 tat er Dienst als Pfarrer im Uellendahl und wurde später langjähriger Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft. Bedeutung für die Wuppertaler Ökumene besaß er schon vor Gründung der ACKuG als engagierter Vorsitzender des aus evangelischen und freikirchlichen Vertretern bestehenden Ökumenischen Arbeitskreises Elberfeld. Er hat zu den ersten Sitzungen eingeladen und war der erste Vorsitzende der ACKuG.
Günther Kuhlmann sei ferner erwähnt. Er war ebenfalls Jahrgang 1931 und verstarb 2015. 1967-1974 Pfarrer und Kirchenrat der Selbständig Evangelisch-lutherischen Kirche (SELK) in Elberfeld. Er war Vertreter der freikirchlichen Gemeinden
Manfred Marquardt muss erwähnt werden. Er war eine junger Delegierter, 1940, also zu Kriegszeiten, geboren. Er lebt heute noch. Damals war er als Pastor der Methodistischen Kirche 1967-1972 in Wuppertal in seiner ersten Pfarrstelle tätig. Später wurde er Prof. in Reutlingen. Er galt den Gründungsmitgliedern als der Vertreter Freikirchen, da er der „Arbeitsgemeinschaft evangelischer Freikirchen in Wuppertal“ vorstand. Darin waren organisiert Evangelisch freikirchliche Gemeinden, Freie evangelische Gemeinden, Evangelisch methodistische Kirche und die Kirche des Nazareners; diese alle wurden zu Gründungsmitgliedern der ACKuG.
Diese und andere mehr waren bewegt und sich auch persönlich zugeneigt in dem einen Bekenntnis. Für sie war Ökumene keine Stilfrage, sondern christlich-existenzielles, Zukunft weisendes Bedürfnis. Bei aller Nüchternheit der Dokumente kann dies vorausgesetzt werden. Warum sonst sollten sie sich so engagiert haben in dieser Zeit. Sie ist ja schon bald nach dem Krieg und 1970 wieder von „institutionellen, an den traditionellen Prinzipien der Lehre orientierten Körperschaften und Hierarchien der Kirchen“ geprägt.
4.
Durch die verschiedenen Aus- und Zusammenschlüsse gab es schon ein gewisses Miteinander. Zumindest war man im Gespräch. Im Frühjahr 1970 gab es dann die entscheidenden Weichenstellungen zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft, die ich jetzt aber nicht darstellen möchte.
Siegfried Meurer war es, der zur konstituierenden Sitzung am 5. Juni 1970 einlud. Sie fand im Unterbarmer Gemeindehaus Martin-Luther-Str. 15 statt, wo man sich übrigens bis in die 1990er Jahre immer traf. Dabei waren je 5 Vertreter der beiden evangelischen Kirchenkreise, je 3 Vertreter der beiden katholischen Stadtdekanate und die Herren Marquardt und Kuhlmann für die Freikirchen. Über die eigentlich Delegierten hinaus waren anwesend Stadtdechant Msgr. Hanisch und „die beiden Dechanten von Barmen und Elberfeld“ und „der Assessor der Synode Elberfeld“. So viel gibt das Protokoll her.
Das Protokoll der konstituierenden Sitzung liegt vor als „Protokollentwurf der Sitzung vom 5.6.1970, Ge.haus Hauptkirche“. Das Kürzel „Fl.“ weist Wilhelm Flender als den Verfasser dieses Protokollentwurfs aus.
Die Satzung der ACK Dortmund wurde zum Vorbild für die der ACK Wuppertal. Die Delegierten schlossen sich ihr weitgehend an.
Es fehlte in der ersten Sitzung noch eine Geschäftsordnung. Sie lag bei der Konstituierung noch nicht vor. „Für die Erstellung eines Entwurfs für die Geschäftsordng. wird Herr Krusenotto gebeten.“ heißt es.
Der Name taucht allerdings unter den protokollierten Anwesenden weder in der ersten noch in der zweiten Sitzung auf. Gemeint ist sicher der Rechtsanwalt Harald Krusenotto, der von 1969 bis 1974 den Wuppertaler Katholikenausschuss leitete und eine bekannte CDU-Persönlichkeit in Wuppertal war.
Am 24.6.70 lud Siegfried Meurer zu einer zweiten Sitzung am 7.7.1970 ein. Er kündigte die Verabschiedung der endgültigen Satzung und die Besprechung der von Herrn Krusenotto entworfenen Geschäftsordnung an.
Das Protokoll der zweiten Sitzung wurde verfasst von Pastor Marquardt. Die Satzung wurde angenommen, ebenso die vorbereitete Geschäftsordnung.
Soweit zur Konstituierung der ACKuG.
Dem sei hinzugefügt, warum die Wuppertaler ACK „ACKuG“ heißt.
Dass die Satzung der ACK Dortmund zum Vorbild für die der ACKuG Wuppertal wurde, gilt auch für die Namensgebung. Hierher – wie auch in der Satzung der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und Gemeinden in Westfalen“ – die 1966 ebenfalls in Dortmund gegründet wurde, stammt der Namenszusatz „und Gemeinden“. Die Dortmunder sprachen allerdings von „Gemeinschaften“. Die Wuppertaler machten daraus „Gemeinden“. Das Protokoll der konstituierenden Sitzung am 7. Juli 1970 vermerkt: „Durchgehend wird bei der Abstimmung über die §§ der Satzung ‚Gemeinschaften‘ durch ‚Gemeinden‘ ersetzt.“
In Wuppertal hat man diese Wortwahl stets bewusst beibehalten, um auf die konfessionelle Vielfalt und Eigenart der Stadt schon im Namen hinzuweisen.
5.
Die Geschichte der ACKuG ist ganz klar eine Erfolgsgeschichte. Und darum feiern wir heute zu Recht das 50jährige Jubiläum.
Dies kann man in vier Punkten darstellen.
a) Es kamen immer mehr Gemeinden und Kirchen hinzu. Bis heute scheint sie attraktiv zu sein.
Schon schnell kamen die Selbstständig Evangelisch-lutherische Kirche (SELK), die Niederländisch-reformierte Gemeinde und etwas später die Griechisch orthodoxe Kirche hinzu. In einem Schreiben an die Mitgliedskirchen und -gemeinden vom 17.12.1973, in dem zur Zahlung der Jahresbeiträge aufgefordert wird, finden sich SELK und die „Niederländer“, nicht aber die Griechisch-Orthodoxen.
Selbstständig Evangelisch-lutherische Kirche (SELK)
Noch im Zusammenhang mit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft kam die Selbstständig Evangelisch-lutherische Kirche (SELK) hinzu. In einer zweiseitigen „Beitrittserklärung“ vom 09.01.1971 teilte das Pfarramt St. Petri einen Beschluss zum Beitritt vom 9. Juni 1970 – also vier Tage nach der ersten Sitzung der ACKuG – im Wortlaut mit. Das Genehmigungsverfahren innerhalb der SELK spare ich mir hier.
Niederländisch-reformierte Gemeinde
Hier konnte bislang der ganz exakte Aufnahmezeitpunkt in die ACKuG in den Unterlagen nicht nachverfolgt werden. In den Unterlagen Wilhelm Flenders findet sich zu Beginn der 70er Jahre allerdings eine Selbstdarstellung der Niederländisch-reformierten Gemeinde von einer DIN-A-4-Seite Umfang.
Miriam Thielemann, langjährig Delegierte der NRG hat mit anderen Gemeindegliedern recherchiert: „Am 16.10.1969 wurde erstmals die Überlegung dokumentiert, eventuell der AcK beizutreten. Die nächste Erwähnung erfolgte erst am 07.02.1972 mit der Aussage, dass der damalige Pastor Klingbeil am nächsten AcK-Termin verhindert sei und der damalige Kirchmeister Helmut Büchsenschütz ihn dort vertreten solle. Der Beitritt ist also offensichtlich in diesem Zeitraum ohne konkrete Dokumentation erfolgt.”
Die niederländisch-reformierte Gemeinde wird in den Unterlagen im Archiv m. E. bei Festlegung des Verteilschlüssels der zu entrichtenden Beiträge am 5.12.1971 erstmals erwähnt (s.o.).
Kurz darauf kam die Griechisch-orthodoxe Gemeinde, wohl 1973, hinzu.
Griechisch-orthodoxe Gemeinde
Im Sommer 1973 diskutierten die Abgeordneten das Priesteramt insbesondere in den Ostkirchen. Am 15.08.1973 wurde festgehalten, dass man dieses Gespräch nicht ohne den griechischen Ortspfarrer Stefanopoulos führen wolle. Der war dann am 19.09.1973 in der Sitzung dabei, als ein Referat des Metropoliten Ireneos zu „Amt und Ordination“ zum Ausgangspunkt der Diskussion wurde. „Er hat auch die Bitte um mehr Gemeinschaft und brüderliche Aufnahme und Austausch in den Familien ausgesprochen. Dem soll entsprochen werden. Brüderlichkeit und Freundschaft sind sehr willkommen,“ vermerkt das Protokoll ausdrücklich. War das die Aufnahme?
Im Jahr 2000 wurde die serbisch-orthodoxe Gemeinde aufgenommen.
Serbisch-orthodoxe Kirche
Im Januar 2000 richtete der Superintendent des Kirchenkreises Elberfeld Andreas Knorr ein Schreiben an den Vorsitzenden der ACKuG Eberhard Batz. Er habe mehrfach mit der serbisch-orthodoxen Kirche zu tun gehabt, sie auch besucht und den Erzpriester Jovan Maric kennengelernt. Die ACKuG möge doch über eine Aufnahme nachdenken. Allerdings hatte Batz schon im August vom Aufnahmewunsch sowohl der serbisch- als auch der russisch-orthodoxen Kirche gesprochen. (Hab ich da etwas übersehen?)
2002 bekam die Credo Kirche, ehemals Christusgemeinde, den Gaststatus.
Credo Kirche Gastmitglied
Die zum Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden gehörende „Credo Kirche“ hat sich vor wenigen Jahren diesen neuen Namen gegeben. Zuvor hieß sie „Christusgemeinde Wuppertal“ (CGW). Am 03.02.1999 stellte sie einen Antrag auf Aufnahme in die ACKuG. Aber erst in der Junisitzung 2002 wurde ein förmlicher Beschluss gefasst, die CGW als Gastmitglied aufzunehmen. (Einem Antrag auf Vollmitgliedschaft wurde im März 2013 nicht stattgegeben, obwohl sich die Gemeinde bei Veranstaltungen und auch als Gastgeber für Sitzungen z.T. stark engagiert zeigte. Ein zweiter Anlauf folgte in der ersten Hälfte 2016. Drei Sitzungen lang wurde diskutiert; doch in der vierten im Juli wurde das Begehren dann doch mit nur ganz knappem Abstimmungsergebnis abgelehnt.)
2007 traten fünf Wuppertaler Mitglieder des Bundes Freier evangelischer Gemeinden der ACKuG bei.
Freie-evangelische Gemeinden
2007 stellten die Freien-evangelischen Gemeinden, also die fünf Wuppertaler Mitglieder im Bund der Freien-evangelischen Gemeinden, nach Gastmitgliedschaft durch Pastor Kraft den Antrag auf Vollmitgliedschaft, dem die Delegierten beschlussmäßig stattgaben.
Im Jahr 2010 kamen zwei Kirchen bzw. ihre Wuppertaler Glieder dazu: die Altkatholische Kirche, die in Düsseldorf Reisholz ansässig ist, und die Russisch-orthodoxe Kirche.
Altkatholische Kirche
Die „Altkatholische Kirche“ kam nach einem Status der Gastmitgliedschaft (seit 2008 „Gaststatus ad personam“) im Jahr 2010 hinzu. Um ihr die Vollmitgliedschaft zu ermöglichen, wurde eine kleine Satzungsänderung notwendig. Die für Wuppertaler Altkatholiken zuständige Gemeinde ist in Düsseldorf ansässig (Thomaskirche Düsseldorf-Reisholz). Im „§ 2 Mitgliedschaft“ hieß es bis 2010; „Mitglied der ACKuG kann jede Kirche oder Gemeinde werden, die in Wuppertal ansässig ist …“ Die Satzung vom 10.03.2010 erweitert die Möglichkeit der Mitgliedschaft auf auch nicht hauptsächlich in Wuppertal ansässige Gemeinschaften: „Mitglied der ACKuG kann jede Kirche oder Gemeinde werden, die in Wuppertal ansässig ist oder deren Gemeindegebiet sich auch auf die Stadt Wuppertal erstreckt …“
Russisch-orthodoxe Kirche
Ebenfalls in der Januar- und der Märzsitzung des Jahres 2010 wurde der Antrag der Russisch-Orthodoxen Kirchengemeinde St. Elisabeth u. Barbara St.-Anna-Kapelle (Vogelsangstr., Kapelle der ehemaligen Landesfrauenklinik) verhandelt. Es bestand großes Einvernehmen: „Nach Diskussion wird auch dieser Antrag einstimmig ohne Enthaltung von allen anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern angenommen.“ Festgehalten wird: Solche „Beschlüsse benötigen zur Gültigkeit die Zustimmung aller Mitglieder der AcKuG (§ 2 , Abs.1, Satz 3).27 Die Zustimmung der heute nicht vertretenen Kirchen und Gemeinschaften muss deshalb noch schriftlich eingeholt werden.“
Die Neuapostolische Kirche wurde dann 2016 Gastmitglied.
Neuapostolische Kirche (NAK) Gastmitglied
Seit 2016 ist die Neuapostolische Kirche als Gastmitglied dabei. Hier gab es eine breite Diskussion im Jahr 2015. Ausschlaggebend war der neue Katechismus der NAK, der im Dezember 2012 erschien, in dem erstmals eine Grundlage für Gespräche zwischen der NAK und der Ökumene vorlag. Er ist Resultat einer Neubesinnung des Selbstverständnisses der NAK seit Beginn der 1990er Jahre.
Die Heilsarmee wurde 2017 Mitglied.
Die Heilsarmee
Der Beitritt der Heilsarmee kündigte sich im Herbst 2016 an. Im Frühjahr 2017 stellte sie einen Antrag auf Aufnahme und wurde bereits im Sommer 2017 als Vollmitglied aufgenommen.
Und die rumänisch-orthodoxe Gemeinde, die erst 2016 gegründet wurde, 2019.
Rumänisch-orthodoxe Gemeinde
Im Januar 2019 wurde die Mitgliedschaft der erst 2016 gegründeten Rumänisch-orthodoxen Gemeinde, die ihre Gottesdienste in St. Michael feiert, sehr unkompliziert festgestellt.
Heute finden sich in der ACKuG Wuppertal 15 Mitglieder: Evangelischer Kirchenkreis, Römisch-katholisches Stadtdekanat, Altkatholische Kirche, Credo Kirche, Evangelisch-freikirchliche Gemeinden, Evangelisch-methodistische Kirche (EmK), Freie evangelische Gemeinden, Griechisch-orthodoxe Kirche, Heilsarmee, Neuapostolische Kirche, Niederländisch-reformierte Gemeinde, Russisch-orthodoxe Kirche, Selbständige Evangelisch-lutherische Kirche (SELK), Serbisch-orthodoxe Kirche, Rumänisch-orthodoxe Kirche.
Zeitweilig waren auch Gruppierungen vertreten, die es heute nicht mehr gibt. Da Bruder Maihöfer heute Abend zugegen ist, möchte ich eine nennen: Die Apostolische Gemeinschaft.
Apostolische Gemeinschaft
Als langjähriges und recht aktives Mitglied schied die „Apostolische Gemeinschaft“ (Hellerstr.), eine Ausgründung der Neuapostolischen Kirche28, im Jahr 2017 aufgrund von Auflösung der Wuppertaler Dependance, deren verbliebene Mitglieder sich jetzt nach Düsseldorf orientieren, aus.29 Sie findet sich zum ersten Mal 1996 im Protokoll,30 Doch es sollte lange dauern, bis sie sich als Gastmitglied etablieren konnte. Und am 07.09.2005 kam sie in den Genuss der Vollmitgliedschaft.
Erwähnt sei noch, dass 1997 es eine Satzungsänderung gab, die die Aufnahme neuer Mitglieder betrifft. Bis dahin stand in der Satzung von 1970 nur: „Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist die Anerkennung der in § 1 bestimmten Grundlagen.“ Nun wurde bei Antrag auf Vollmitgliedschaft die Zustimmung der entsendenden Kirchen und Gemeinden und bei Gastmitgliedschaft das „Quorum von zwei Dritteln der Mitglieder“ festgeschrieben. Hinzu kam nach ausführlicher Beratung im April 1998 und der Einsetzung einer kleinen Arbeitsgruppe im August 1998 ein förmliches Mindestverfahren für die Aufnahme neuer Kirchen bzw. Gemeinden und ein zu benutzender Fragenkatalog.
b) zur Erfolgsgeschichte ACKuG
Der intensive theologische Austausch zeigt eine Geschichte der ACKuG als Vertrauensgeschichte.
Die ACKuG hat immer den ökumenischen Austausch gesucht. Es gibt keine Spuren in den Protokollen und Unterlagen, dass man sich theologisch gefetzt oder Urteile an den Kopf geworfen oder gar überworfen hat. Immer waren die Delegierten bemüht, darzustellen und zuzuhören und Fragen zu stellen.
Die Themen, denen man sich stellte, waren sicherlich brisant genug, um aneinander geraten zu können oder konfessionalistische Abgrenzungen vorzunehmen.
Beipiele für Themen sind: das Priesteramt in der orthodoxen Tradition, das Messopfer31, die KEK32, die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung33, die Charta oecumenica34, Erklärung „Dominus Iesus“35, Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“36. In den letzten Jahren waren das Sakraments- und das Missionsverständnis u.a..
So kam es – und das möchte ich betonen – zu immer tieferem gegenseitigen Verständnis und Vertrauen zueinander.
In den ersten Jahren fällt allerdings die sozial-diakonische Verantwortung auf, die die Delegierten wahrnahmen. In den Jahren 1973-1974 widmeten sie sich ausführlich der „Gastarbeiter-Frage“. Sie unterstützten eine „Clearing-Stelle“ des Elberfelder Erziehungsvereins: „Sie soll der Aufgabe und Beratung und Vermittlung von Plätzen in den vorhandenen Kindergärten für Kinder von Gastarbeitern dienen (Richtsatz ca. 10 %).“ Oder sie verfassten eine Stellungnahme zum „Tag des ausländischen Mitbürgers“ am 12.10.1975. Und sie „mitinitiierten“ eine „Aktionsgemeinschaft“ „Der behinderte Mensch“.
Und politisch agierte die Arbeitsgemeinschaft insbesondere im Jahr 1981, indem sie sich intensiv mit der Friedensproblematik beschäftigte, dabei den Hamburger Kirchentag und die Großdemonstration im Bonner Hofgarten im Auge hatte, und eine Friedenswoche unterstützte.
Bezeichnenderweise hat kein Thema die Abgeordneten zur ACKuG auch nur annähernd so lange beschäftigt wie die Konvergenzerklärung über Taufe, Eucharistie und Amt, meist „Lima-Papier“ genannt. Themenabschnittsweise wurde sie durchgearbeitet. In allen (!) Protokollen vom 19.10.1983 bis zum 10.09.1986 – also drei Jahre – werden die Gesprächsgänge mehr oder weniger ausführlich beschrieben. 1987 wurde das Thema wieder aufgegriffen.38 Aber noch bis in die 1990er Jahre war die Limaerklärung immer wieder Thema. Am 06.03.1991 diskutierten die Abgeordneten erneut hierüber aus Anlass der „Aufnahme des Limapiers in der evangelischen Landeskirche.“
Und zum 25jährigen Jubiläum der ACKuG 1995 wurde in der Friedhofskirche ein Ökumenischer Gottesdienst nach der Limaliturgie gefeiert.
c) zur Erfolgsgeschichte der ACKuG gehört:
Die ACKuG hat immer für Kirche und Stadt wesentliche Veranstaltungen geplant und durchgeführt.
Am Anfang bis in die 1990er Jahre waren es die „Wuppertaler Grenzgespräche“. Hochkarätige Referenten wurden eingeladen. Zu Anfang waren sie auch wohl recht erfolgreich bis das Format nicht mehr so zog.
Hier einfach ein paar Namen, Professoren aus der ersten Reihe insbesondere der Theologensippe:
Wolfhart Pannenberg, Gotthold Hasenhüttel, Heinz Zahrnt, Walter Hollweger, Johann Baptist Metz, Eberhard Jüngel, Pinchas Lapide, Heinrich Fries, Catharina (Tine) Joanna Maria Halkes, Konrad Raiser u.a.
Beispiele für „Wuppertaler Grenzgespräche“:
28.10.1970 Aula Gymnasium Sedanstr., Wuppertaler Grenzgespräche, mit Sepp Schulz, „Abschied von den Kirchen?“
25.11.1970 Johann-Breuer-Saal, Wuppertaler Grenzgespräche, mit Prof. Dr. Franz Böckle, „Säkularisierte Moral?“
28.04.1971 Aula Gymnasium Sedanstr., Wuppertaler Grenzgespräche, Podiumsgespräch „Das Gesetz des Staates und die sittliche Entscheidung“, Moderator Siegfried Meurer
26.04.1972, Gemeindehaus Gemarker Kirche Wuppertaler Grenzgespräche, mit Rev. R.R. Davey, Belfast (Protestant Church of Ireland) und Margarete Zimmer, Belfast (Katholische Kirche), „Hoffnung für Nordirland?“
Wuppertaler Grenzgespräche – „Doppelveranstaltung“; „Glaube–Ja – Kirche–Nein?“40
22.11.1974 Prof. Dr. Wolfhart Pannenberg
29.11.1974 Prof. Dr. Gotthold Hasenhüttel
Aber auch ganz andere Veranstaltungen gab es:
Am 07.11.1971 ein Geistliches Konzert im Großen Saal der Stadthalle Wuppertal (!), mit mehreren Chören aus der evangelischen und der katholischen Kirche und aus freikirchlichen Gemeinden; dazu spielte das Sinfonieorchester des Stabsmusikkorps Siegburg.
Am 09.06.1979 ein Gottesdienst auf dem Rathausvorplatz als Hauptbeteiligung der ACKuG am 50. Wuppertaler Stadtjubiläum. Damit hatte sich die Arbeitsgemeinschaft sehr intensiv im Herbst 1978 und Frühjahr 1979 beschäftigt.
Die ACKuG war Veranstalter beim Bibelzug in Wuppertal 20.-22.04.1992. Sie unternahm mit 20 Teilnehmenden 1993 eine Studienfahrt nach Genf zum ÖRK, veranstaltete sog. „Ökumenetage“, im Jahr 2000 einmal eine Busrundfahrt unter der Überrschrift „Kirchen in Wuppertal mehr als Baudenkmale“, dreimal eine „Nacht der Offenen Kirchen“ (2005, 2008, 2012), Pfingstgottesdienste openair, „Ökumenische Pfingsttreffen“, z.B 2013 in der Unterbarmer Hauptkirche mit Prof. Erich Geldbach zum Thema „Säkularisierung“, oder: 2014 „Mit Sang und Klang“ ein Liedersingen der wichtigsten Choräle der in der ACKuG Wuppertal zusammengeschlossenen Kirchen und Gemeinden.
Erwähnenswert noch: 2017 das „Christusfest“ – ein Reformationsgedenken als ökumenisches Mit- und nicht wie in früheren JAhrhunderten als eine Abgrenzung.
Unbedingt erwähnenswert die Veranstaltung : „Verfolgte Christen heute“ mit Workshops, im Katholischen Stadthaus. Referent: Matthias Kopp, Pressesprecher, Leiter der Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Bischofskonferenz
oder der Ökumenischer Openairgottesdienst 2020 im Autokino, Carnaper Platz
Und zum Schluss noch der Punkt d) zur Erfolgsgeschichte ACKuG.
Hierzu lese ich nur ein Zitat von Paul Meisenberg, langjähriger römisch-katholischer Delegierter und zeitweiliger Vorsitzender der ACKuG
der mich persönlich in seinen ökumenischen Bestrebungen beeindruckt hat und sicher daran schuld ist, dass ich heute in der ACKuG aus Überzeugung mitarbeite.
Paul hat schon im Jahr 2000 geschrieben:
„Die Arbeitsgemeinschaft hat es über Jahrzehnte hinweg als eine wichtige Aufgabe angesehen, für ein gutes Klima unter den verschiedenen Kirchen und Gemeinden Wuppertals Sorge zu tragen und ökumenische Aktivitäten anzuregen. Wenn die Atmosphäre zwischen den zahlreichen kirchlichen Gemeinschaften hier durchweg sehr gut war, ist das sicher auch ein Verdienst der ACKuG.“
Die ACKuG hat es vermocht, solche Verständigung fortzuführen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.