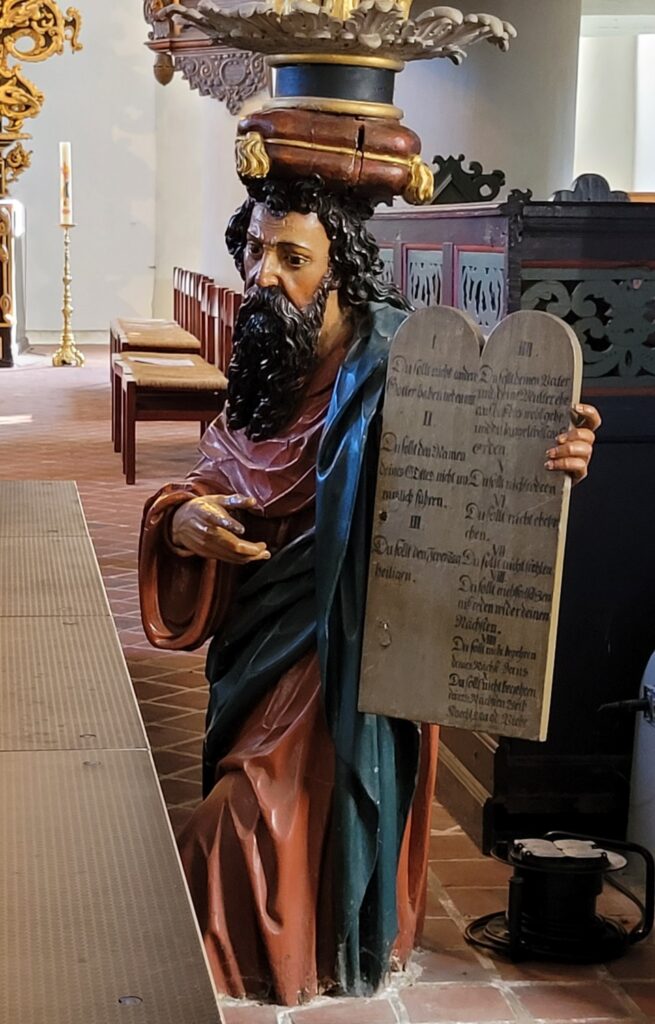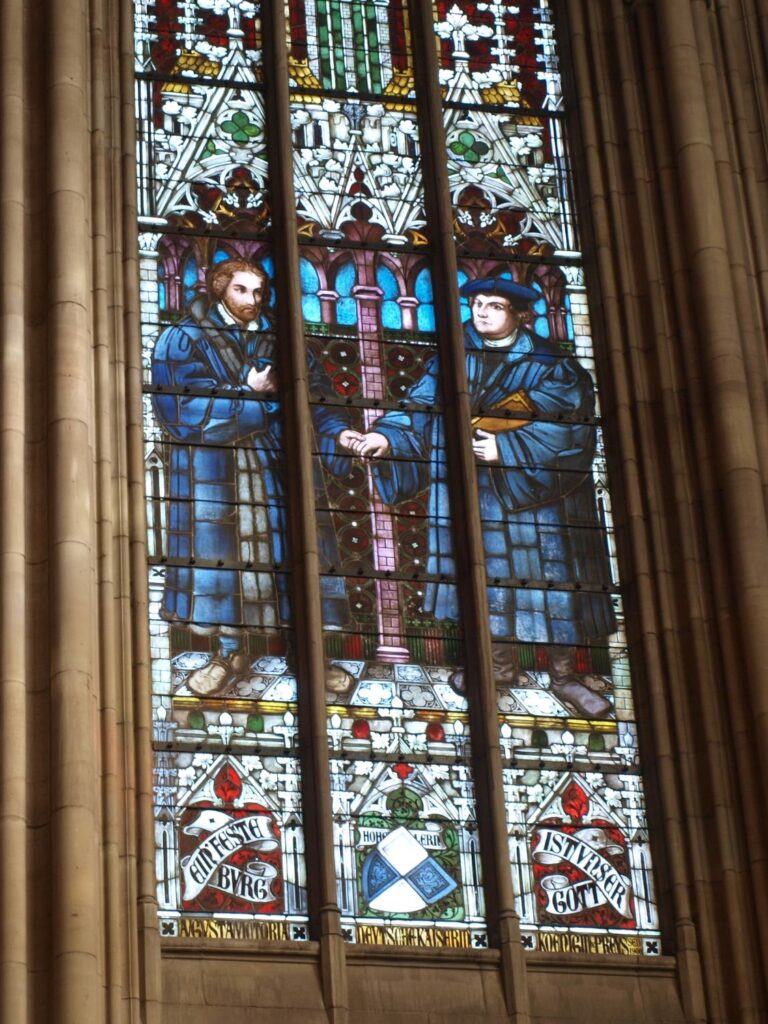Predigt
Reformationstag 2014
„Die Frage nach der Seligkeit“
Philipper 2,12-13
12 Also, meine Lieben, – wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit – schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern.
13 Denn Gott ist’s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.
Liebe Gemeinde!
1.
Heute ist Reformationstag!
Die Erkenntnis Martin Luthers war: Nicht aus Werken, nicht aus eigenem Tun, und sei es noch so gut, an den Mitmenschen und vor Gott, wird ein Mensch selig. Die Seligkeit kann sich niemand erarbeiten!
Sondern sie kommt aus dem Glauben.
Im Evangelium wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar. Das Evangelium erzählt von Jesus Christus, der alle menschliche Schuld ans Kreuz getragen hat. Nur durch diesen Gnadenakt Gottes kann ein Mensch überhaupt vor Gott bestehen, weil Jesus Christus das auf sich genommen hat, was einem Menschen zu leisten unmöglich ist.
Im Glauben hieran findet der Mensch Leben, Leben vor Gott, Leben bis über die Grenze des Todes hinaus.
Darum hatte Luther gegen den sog. Ablasshandel gewettert. Durch die kirchlichen Ablassbriefe wurde in schamloser Weise die Angst der Menschen ausgenutzt, vor Gott nicht bestehen zu können und ihre Seligkeit zu verlieren.
Hier im Predigttext aber heißt es nun: Schaffet! Schaffet dass ihr selig werdet!
Und hinzu gefügt wird der Zusatz: mit Furcht und Zittern!
Predigt der Philipperbrief nun doch die Frömmigkeit nach dem Gesetz: Tut Gutes und Gott wird Euch belohnen? Habt Angst vor dem großen Gott und seinem Strafen und verschafft Euch durch Eure guten Werke Ablass der Sünden, damit Ihr selig werdet?
2.
Liebe Gemeinde, diese Fragen hätten dann ihr Recht, wenn Paulus seinen Brief in ein Neuland geschrieben hätte, also zu Menschen, die nichts vom christlichen Glauben wissen. Nein, er schreibt an sie, die in die Nachfolge getreten sind und in ihr stehen. Dankbar erkennt Paulus, dass die Philipper die Gaben Gottes in Christus bei sich haben, den „Trost der Liebe, … Gemeinschaft des Geistes, … herzliche Liebe und Barmherzigkeit“. (2,1) Und er beginnt den Brief an die Philipper sogar damit, dass er seine gute Zuversicht zum Ausdruck bringt, dass Gott in den Philippern das gute Werk angefangen hat.
Da wäre Paulus wohl kaum auf die Idee gekommen, ausgerechnet diese Philipper in die Situation vor ihrer Bekehrung zurückzuversetzen, nur jetzt unter christlichem Vorzeichen. Bevor sie sich dem christlichen Glauben zugewendet hatten, waren auch sie wie weitgehend die ganze Antike voller Angst darauf bedacht, durch Altäre und Opfergaben die Gunst der Götter erwirken.
Die Philipper werden angesprochen als die, die erfüllt sind vom Glauben, besser von Gott und seinem guten Geist, der in ihnen wirkt. Sie leben ja nicht mehr in den alten religiösen Betätigungen, sondern gestalten ihr Leben als Christinnen und Christen. Sie waren ja gerade von der falschen Gottesfurcht Befreite, so wie wir uns als Protestanten als Gerechtfertigte wissen, als Protestierende gegen einen Glauben der Werke.
„Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern.“ Paulus möchte, dass sie nicht das Ziel verfehlen, dass sie nicht herausfallen, sich lösen, lasch werden, sondern beständig bleiben und sich nicht ablenken lassen auf dem Weg dem Ziel entgegen.
Paulus weiß von sich selbst, wie der Glaube ist und sein kann.
Er weiß von den Gefahren und Gefährdungen des Glaubens, von Verfolgungen auch, die den Glauben ins Wanken bringen können. Er weiß, dass wir Menschen den Schatz des Evangeliums nur in tönernen, also zerbrechlichen Gefäßen haben. (2. Korinther 4,7)
Nachher wird er im Philipperbrief, dem unser Predigttext entnommen ist, schreiben (Kapitel 3):
12Nicht, dass ich’s schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich’s wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin.
13Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich’s ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist,
14und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.
3.
Schaffet dass ihr selig werdet! Der Aufruf des Paulus trifft auch bei uns nicht in ein Neuland. Wir sind durchaus Menschen, die spüren, dass der Glaube, dass Gott uns trägt. Wir wissen von Jesus Christus. Wir trachten danach, „vor Gott in Heiligkeit zu wandeln“, wie wir manchmal singen. Wir sind heute Abend in die Kirche gekommen. Wir gehören also zu den Menschen, die sich um ihren Glauben kümmern. Wir suchen bewusst, unsere Gottesbeziehung zu pflegen. Insofern gleichen wir den Philippern.
Und genau wie für die Philipper ist der sorgende Ausruf des Paulus: „Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern!“ auch hilfreich für uns. Denn auch unser Glaube ist immer ein gefährdeter. Die Gefahren mögen andere sein in den unterschiedlichen Zeiten und an den unterschiedlichen Orten. Diese allgemeine Feststellung kann aber nur die Frage nach sich ziehen, wodurch denn konkret unser Glaube gefährdet ist.
a)
Ich meine, dass wir vor allem in der Gefahr stehen, vom Sog der Zeit erfasst zu werden, oder wir sind schon erfasst davon.
Wir fragen heute kaum noch oder gar nicht mehr oder nur wenig nach der „Seligkeit“, wie es hier im Text heißt oder nach unserem „Seelenheil“. Viele halten die Frage danach geradezu für überflüssig.
Dabei spielte sie in der Geschichte der Christenheit immer eine Rolle. Die Sorge um die eigene Seele war immer eine existenzielle. Gerade die Antwort, die der Glaube gibt, dass Gott für die Seele gesorgt hat, haben unzählige Menschen dankbar angenommen und aus ihr heraus ihren Glauben gelebt.
Und dann kam – lange ist das noch gar nicht her, die Zeit, in der manche den Christen nachsagten, dass sie sich ein bisschen zu viel um ihr Seelenheil kümmern würden. Es wurde gesagt, sie würden ihren Glauben rein verinnerlicht leben. Die guten Werke hingegen kämen zu kurz. Darum müsse man sich kümmern. Ein Einsatz für den Frieden und Gerechtigkeit sei angesagt. Der Einsatz für Menschen in Not sei angesagt.
Ich will das jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen Menschen und es ist eine christliche Pflicht, sich für andere einzusetzen. Das ist alles selbstverständlich. Und gerade die Anliegen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung (die auf den sog. „konziliaren Prozeß“ zurückgehen) fassen heutige Hauptanliegen gelebten Christentums zusammen.
Mir scheint aber gerade das, wovon manche annahmen oder noch annehmen, dass es zu viel sei, heute eher zu wenig ist. Die Frage nach der Seligkeit, die Frage nach dem Seelenheil, die Frage danach, in welcher Beziehung ich eigentlich zu Gott stehe, oder die noch weitergehende Frage, ob Gott mir Sünder gnädig ist, spielen überhaupt keine Rolle mehr.
Das, was für Menschen einmal das „Seelenheil“ war, wird heute als das „Glück“ bezeichnet – ich möchte sagen reduziert auf den Begriff „Glück“. Um ihr Glück kümmern sich heute Menschen. Da suchen sie ihr „Heil“. Das Glück liegt in dem, was man sich leisten kann, in dem, was man darstellt, in der Ausübung eines Hobbies … Eine Debatte, die diese Frage über den Tellerrand des persönlichen Wohlbefindens hinaus stellt, kommt nicht einmal mehr in den Blick; denn – so wird postuliert – jeder ist seines Glückes Schmied und die Frage nach Gott und dem persönlichen Verhältnis und danach, was das denn für mein Selbstverständnis und mein Wohlbefinden, für meine Seele und meine seelische Gesundheit bedeuten kann, scheint eher verstörend zu wirken und wird als unangemessen und nicht wesentlich angesehen.
Und doch ist das Gegenteil der Fall.
In dieser Woche hat mir jemand gesagt: „Ich orientiere mich nicht nach oben.“ Die meisten, eigentlich wir alle, orientieren uns aber durchaus nach oben, D.h. wir orientieren uns daran, wie andere Menschen (vermeintlich) glücklich sind, an dem was ihnen offenbar das Glück und die Zufriedenheit verschafft. Freie Zeit, Reisen, Zeitvertreib, etwas, was begeistert …
Ich habe einmal einen Mann kennen gelernt, der nach außen hin alles Glück der Erde hatte: eine Familie, die zusammen hielt, Kinder, die „geraten waren“, großen materiellen Wohlstand, Reisen in alle Welt und jeden Kontinent. Und doch würde ich sagen, kannte er kein Seelenheil. Er eilte von einem zum anderen. Und als seine Frau verstarb, brach diese so wohl eingerichtete Welt wie ein Kartenhaus zusammen. Er hatte nichts zuzusetzen, keinerlei Halt.
Das ist unsere Gefahr heute, weswegen wir den Aufruf des Paulus als hilfreich erleben können, dass auch wir aufgrund dessen, wie wir uns eingerichtet haben in der Welt, uns die Frage nach Gott und Glauben wenig relevant vorkommt.
Der Aufruf des Paulus lässt ruft uns in eine Besinnung auf die elementare Frage, die Luther gestellt hat: Sind die Fragen, die Martin Luther aufgeworfen hat, für mich noch bedeutsam? Was zählt vor Gott? Was zählt vor meinem Schöpfer? Und die Antwort: Ich kann nichts erbringen!, also die ganze Zuwendung Gottes: trägt sie mich auch heute noch?
„Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern.“
b)
Ich möchte noch einen Schritt weitergehen.
Auch die absolute Kernfrage Martin Luthers kann uns durchaus zu schaffen machen, also die Frage nach dem dem Schuldigen gegenüber gnädigen Gott. Sie ist nicht ein Relikt des 16. Jahrhunderts. Ganz im Gegenteil. In unseren Reihen und auch bei Menschen, die dem Glauben gar nicht nahe stehen, hat sie manchmal sogar verheerende Wirkungen.
Wie kann ich mit meiner Schuld umgehen? Wie kann ich mein begangenes Unrecht wieder gut machen? Wie kann ich das gut machen, was nicht mehr gut zu machen ist, weil der Mensch, an dem ich mich vergangen habe, nichts mehr von mir wissen will, nicht mehr greifbar ist, nicht mehr lebt? Bis hin zur Verzweiflung versuchen Menschen mit diesen Fragen umzugehen. Heute. Schuldbewusstsein und Gewissensnot sind Begleiter auch und gerade moderner Menschen.
Und darum ist es wichtig und existenziell entscheidend, zu lesen, was der zweite Satz des Predigttextes beteuert: „Gott selbst ist es, der in dir wirkt!“ Das sollen die Christen in Philippi, das sollen wir wissen.
Und wer sich darauf einlässt, wer im Glauben Gottes Wirken in sich annimmt und zulässt, der wird sagen können, was R. Bultmann in einer Predigt zu diesem Bibeltext schreibt:
„Nun ist Seligkeit nicht ein wehmütiger Trostgedanke, den das verzweifelte Herz im Druck des Lebens ersinnt, an den es seine Wünsche und Hoffnungen anklammert und der vom Sturm des Lebens nur zu bald hinweg geweht wird.“ (R. Bultmann)
Wie geht das, Gottes in mir selbst wirken zu lassen?
„Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Ich glaube, dieser Satz des Paulus sagt es.
„Lass dir an meiner Gnade genügen!“ Das ist das, was wir Menschen nicht schaffen. Wir wollen immer noch etwas tun, meinen, das erste sei etwas anderes.
Aber Gottes Gnade ist genug für uns. Es bedarf keinerlei Aktivität, um Schuld ablegen zu können. Jesus Christus hat genug getan. Er hat sein Leben dahin gegeben. Er hat auf sich genommen, was uns belastet. Dies im Glauben anzunehmen, heißt, sich an seiner Gnade genug sein zu lassen. Mehr brauchst Du nicht.
Dafür muss man nicht erst Christ geworden sein, ein Glaubensbekenntnis gesprochen haben oder sogar getauft zu sein. Nein, dass kann auch jeder „säkularisierte“ Mensch, der eigentlich Gott und dem Glauben distanziert oder gleichgültig gegenübersteht.
Hier findet auch er Hilfe und Kraft und einen Neuanfang, wenn er sich Gottes Gnade genug sein lässt.
Liebe Gemeinde,
„Gott ist’s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“
Darauf können, dürfen uns sollen wir uns verlassen.
Martin Luther hat gesagt: „Mit unsrer Kraft ist nichts getan!“
Gott selbst bewirkt in uns das Wollen und Vollbringen.
An dieser Gnade lasst uns genug sein!
Amen.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.