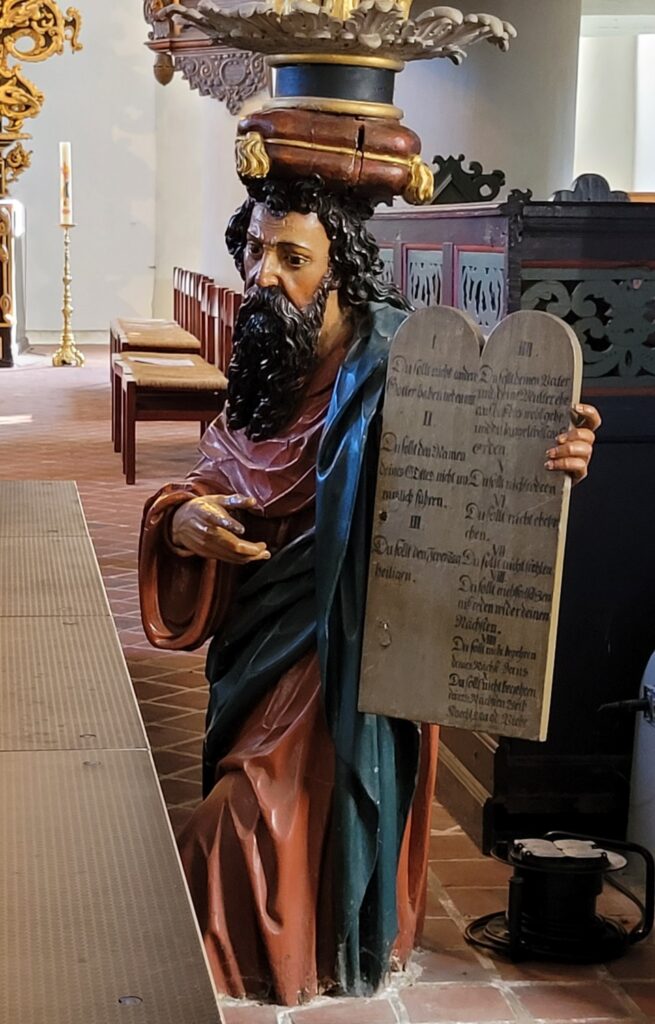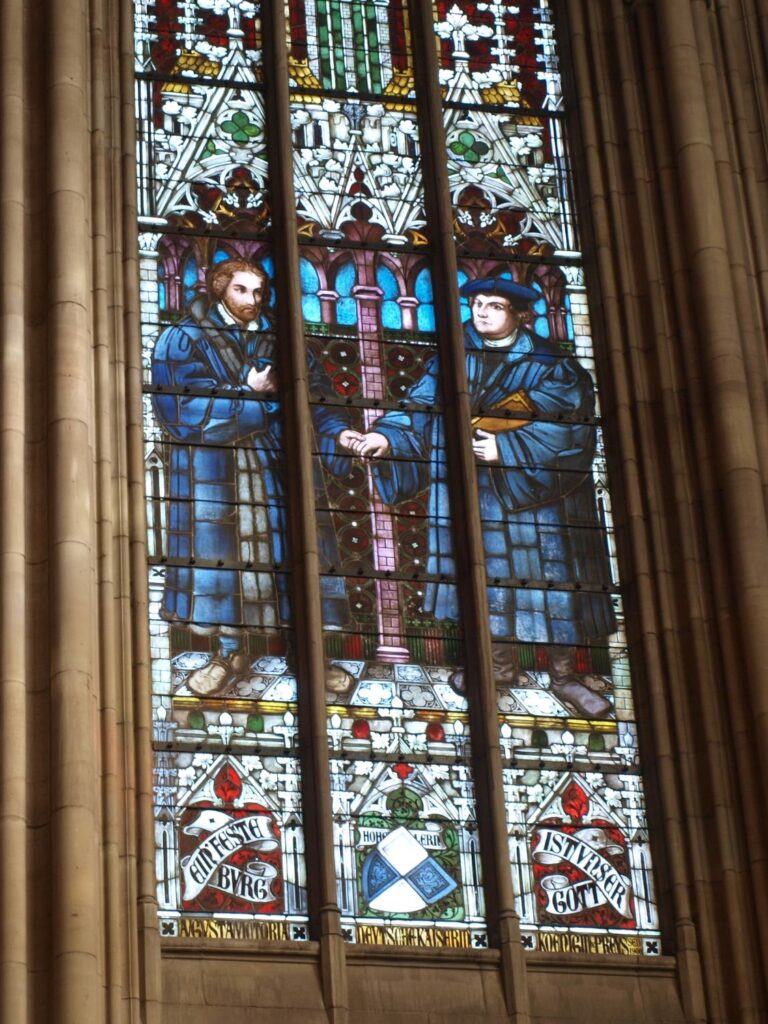Am 15. Februar 2009 – fand unter der Überschrift „In alle Herzen ist ein Empfinden um die Gottheit eingeschrieben.“ (Johannes Calvin, Institutio) zum 500. Geburtstag Johannes Calvins in der Johanneskirche Wuppetal eine Lesung von Texten aus der Feder des Reformators statt. Umrahmt wurden sie von Gitarren- und Flötenmusik.
Die Texte:
Einführung: Es ist unmöglich, mit wenigen Texten auch nur annähernd das umfangreiche erhaltene Schrifttum Calvins repräsentativ zu erfassen. Allenfalls ein paar mehr oder weniger zentrale Inhalte können geboten werden. Calvins schriftlicher Nachlass umfasst im sog. Corpus reformatorum mehr als 22.000 Druckseiten in 59 Teilen.
- mehr als 1.200 Briefe sind erhalten
- 874 Predigten erhalten; viele sind verloren gegangen
- er hat fast alle biblischen Bücher umfangreich kommentiert
- Er ist vor allem der Verfasser der berühmten Institutio christianae religionis, die aus einer Verteidigungsschrift 1536 zu einer umfangreichen Dogmatik wuchs, mit deren Letztausgabe 1559 Calvin endlich zufrieden war.
Text 1 – Calvin über sich selbst
Es ist gleichgültig zu erwähnen, wie viel niedriger meine Stellung ist. Doch wie [David] von den Schafweideplätzen fort zur höchsten Königswürde erhoben wurde, hat Gott mich aus meinen dunklen und geringen Anfängen emporgehoben und mich mit dem so ehrenvollen Amt betraut, Verkündiger und Diener des Evangeliums zu sein. Mein Vater hatte mich schon als kleinen Jungen zum [Studium] der Theologie bestimmt. Als er aber sah, dass die Rechtswissenschaft die, die sich ihr verschrieben haben, in aller Regel reicher macht, bewegte ihn diese Aussicht plötzlich zur Änderung seines Plans. So kam es, dass ich vom Studium der Philosophie abgebracht wurde und zur Rechtswissenschaft wechselte. So sehr ich dem Willen meines Vaters gehorsam war und versuchte, mich diesem Studium treu zu widmen, so hat doch Gott schließlich durch den verborgenen Zügel seiner Vorsehung meinen Weg in eine andere Richtung gelenkt.
Zunächst aber war ich dem Aberglauben des Papsttums so hartnäckig erlegen, dass es nicht leicht war, mich aus diesem tiefen Sumpf herauszuziehen. Darum hat [Gott] mein trotz seiner Jugend schon recht starres Herz durch eine unerwartete Bekehrung zur Gelehrsamkeit gebracht. Erfüllt vom Geschmack an wahrer Frömmigkeit, entbrannte ich in einem solchen Eifer, darin Fortschritte zu machen, dass ich die übrigen Studien zwar nicht fallen ließ, wohl aber ziemlich nachlässig betrieb. Noch war kein Jahr vergangen, da kamen alle, die nach der reinen Lehre verlangten, zu mir, dem Neuling und Anfänger, um zu lernen. Von Natur aus schüchtern, habe ich die Zurückgezogenheit und Ruhe stets geschätzt und deshalb danach gestrebt, im Verborgenen zu leben. Das ist mir aber so wenig vergönnt gewesen, dass aus jedem Versteck gleichsam eine öffentliche Schule wurde. Während es meine einzige Absicht war, unbeachtet in Ruhe leben zu können, hat Gott mich so von Ort zu Ort getrieben, dass er mich nirgends Ruhe finden ließ, bis ich meinem Widerstand zum Trotz ins helle Licht [der Öffentlichkeit] gezogen wurde. Ich verließ mein Vaterland und reiste nach Deutschland in der Absicht, in irgendeinem verborgenen Winkel versteckt meine mir seit langem versagte Ruhe zu genießen.
Doch siehe, als ich mich unerkannt in Basel verborgen hielt, wurden in Frankreich viele fromme Leute verbrannt und, weil die Scheiterhaufen bei den Deutschen überall für große Empörung sorgten, niederträchtige verlogene Büchlein verbreitet, um diese [Empörung] zu dämpfen: [Darin hieß es,] nur Wiedertäufer und Unruhestifter seien so grausam verfolgt worden, die durch ihre verkehrten Ansichten nicht nur die Religion, sondern auch die gesamte öffentliche Ordnung zerstören wollten. Meiner Auffassung nach wurden [diese Lügen] vom [französischen] Hof in die Welt gesetzt, um einerseits durch die fälschliche Beschuldigung der heiligen Märtyrer das schändliche Vergießen unschuldigen Blutes zu vertuschen, und um andererseits später weiter morden zu können, ohne dadurch Mitleid anderer zu erregen. Würde ich dazu schweigen, träfe mich – so meinte ich – der Vorwurf des Verrats, es sei denn, ich träte dem nach Kräften entgegen. Aus diesem Grund habe ich meinen Unterricht [in der christlichen Religion] geschrieben: erstens, um meine Brüder, deren Tod in den Augen des Herrn so viel galt, gegen eine ungerechte Verleumdung zu verteidigen; zweitens, um für die vielen Verfolgten, denen dieselbe Strafe drohte, wenigstens etwas Mitleid und Anteilnahme im Ausland zu wecken. Allerdings war das damals [noch] nicht das umfangreiche und mühevoll ausgearbeitete Werk, das jetzt vorliegt, sondern nur ein kurzes Handbuch zu dem einzigen Zweck, den Glauben derer zu bezeugen, die nach meinem Eindruck von gottlosen und niederträchtigen Schmeichlern in verbrecherischer Weise verleumdet wurden.
Dass es nicht in meiner Absicht lag, mir damit einen Namen zu machen, geht deutlich aus meiner baldigen Abreise [aus Basel] hervor, zumal dort niemand wurste, dass ich der Verfasser war. Auch andernorts habe ich das stets verschwiegen und geplant, von diesem Verhalten nicht abzuweichen. Dann aber wurde ich in Genf nicht in erster Linie durch einen Rat oder eine Ermahnung, sondern vielmehr durch eine furchtbare Beschwörung Wilhelm Farels festgehalten, als ob Gott vom Himmel her seine starke Hand auf mich gelegt hätte. Weil ich auf direktem Weg nach Straßburg reisen wollte, [dieser Weg] mir aber durch Kriegshandlungen verschlossen war, entschied ich mich dafür, rasch durch [Genf] zu ziehen und nicht länger als eine Nacht in der Stadt zu bleiben. Durch das Wirken dieses hervorragenden Mannes und Pierre Virets war hier vor kurzem das Papsttum abgeschafft worden. Noch aber waren die Verhältnisse ungeordnet und die Stadt in schlimme und gefährliche Parteien gespalten. Ein Mann, der nach schändlichem Abfall wieder ins Lager der Papstanhänger zurückgekehrt ist, sorgte sofort für die Offenlegung meiner Identität. Farel aber — von unglaublichem Eifer zur Verbreitung des Evangeliums beseelt — richtete alle Anstrengungen beharrlich darauf, mich dazubehalten. Als er sah, dass ich mich in aller Stille dem Privatstudium hingeben wollte, und erkannte, dass er durch Bitten nichts bei mir erreichen konnte, ließ er sich zu einem Fluch hinreißen: Gott möge meine Ruhe verwünschen, wenn ich mich in einer solchen Notlage der Hilfeleistung entziehe. Dieser Schreck erschütterte mich derart, dass ich die begonnene Reise nicht fortsetzte.
CStA 6,25ff
Text 2 – Calvins Selbstverständnis
Ich will mir keinerlei Scharfblick, Bildung, Klugheit oder Gewandtheit, ja nicht einmal Sorgfalt zuschreiben. Dass ich aber mit der Lauterkeit, die Gottes Werk wohl ansteht, hier tätig gewesen bin, dessen bin ich mir vor dem Angesicht meines Richters Christus und vor all seinen Engeln bewusst, und alle redlichen Menschen stellen mir hierhin ein glänzendes Zeugnis aus. Wenn es also feststeht, dass dieser Dienst vom Herrn stammt — und das tritt gewiss klar zu Tage, sobald man den Streitfall nur untersucht —, ich aber ihn schweigend von Euch zerpflücken und verdächtigen lassen wollte: Wer müsste ein solches Schweigen nicht als Pflichtvergessenheit verurteilen? Das also sieht jeder, dass ich durch den unwiderstehlichen Zwang meines Amtes gebunden bin und unmöglich darum herumkomme, mich Euren Anschuldigungen entgegenzustellen, wenn ich meine von Gott mir übertragene Arbeit nicht in offenkundiger Fahnenflucht im Stich lassen und verraten wollte. Wenn ich freilich im Augenblick von der Verwaltung der Genfer Kirche freigestellt bin, so darf das noch nicht dazu führen, dass ich sie nicht weiterhin mit väterlicher Liebe umsorgte; denn hat Gott mich einmal an ihre Spitze gestellt, so hat er meine Treue für immer an sie gebunden.
Lesebuch, 13
Text 3 – Gottes- und Menschenerkenntnis
“TOTA fere sapientiae nostrae summa, quae vera demum ac solida sapientia censeri debeat, duabus partibus constat, Dei cognitione et nostri.” (Opera Selecta, 31) = erster Satz der Institutio – Alles, was Calvin geschrieben hat, hat er auf Latein oder Französisch geschrieben. Deutsch konnte er nicht.
All unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde eigentlich zweierlei: die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Diese beiden aber hängen vielfältig zusammen, und darum ist es nun doch nicht so einfach zu sagen, welche denn an erster Stelle steht und die andere aus sich heraus bewirkt. Es kann nämlich erstens kein Mensch sich selbst betrachten, ohne sogleich seine Sinne darauf zu richten, Gott anzuschauen, in dem er doch »lebt und webt« (Apg 17,28). Denn all die Gaben, die unseren Besitz ausmachen, haben wir ja offenkundig gar nicht von uns selber. Ja, selbst unser Dasein als Menschen besteht doch nur darin, dass wir unser Wesen in dem einigen Gott haben! Und zweitens kommen ja diese Gaben wie Regentropfen vom Himmel zu uns hernieder, und sie leiten uns wie Bächlein zur Quelle hin.
Noch viel deutlicher aber wird gerade in unserer Armut der unermessliche Reichtum aller Güter erkennbar, der in Gott wohnt. Besonders zwingt uns der jämmerliche Zerfall, in den uns der Abfall des ersten Menschen hineingestürzt hat, unsere Augen emporzurichten. Hungrig und verschmachtend sollen wir von Gott erflehen, was uns fehlt, aber zugleich auch in Furcht und Erschrecken lernen, demütig zu sein. Denn der Mensch birgt ja in jeder Hinsicht eine Welt von Elend in sich, und seitdem wir der göttlichen Zier verlustig gegangen sind, macht eine beschämende Blöße unendlich viel Schande offenbar. Ist es aber so, dann muss ja notwendig jeder Mensch vom Bewusstsein seines heillosen Zustandes wenigstens zu irgendeinem Wissen um Gott getrieben werden: Wir empfinden unsere Unwissenheit, Eitelkeit, Armut, Schwachheit, unsere Bosheit und Verderbnis — und so kommen wir zu der Erkenntnis, dass nur in dem Herrn das wahre Licht der Weisheit, wirkliche Kraft und Tugend, unermesslicher Reichtum an allem Gut und reine Gerechtigkeit zu finden ist. So bringt uns gerade unser Elend dahin, Gottes Güter zu betrachten, und wir kommen erst dann dazu, uns ernstlich nach ihm auszustrecken, wenn wir angefangen haben, uns selber zu missfallen. Denn von Natur hat jeder Mensch viel mehr Freude daran, sich auf sich selber zu verlassen, und das gelingt ihm auch durchaus — solange er sich selber noch nicht kennt, also mit seinen Fähigkeiten zufrieden ist und nichts von seinem Elende weiß oder wissen will. Wer sich also selbst erkennt, der wird dadurch nicht nur angeregt, Gott zu suchen, sondern gewissermaßen mit der Hand geleitet, ihn zu finden.
Aber andererseits kann der Mensch auf keinen Fall dazu kommen, sich selbst wahrhaft zu erkennen, wenn er nicht zuvor Gottes Angesicht geschaut hat und dann von dieser Schau aus dazu übergeht, sich selbst anzusehen. Denn uns ist ja ein mächtiger Hochmut geradezu angeboren, und darum kommen wir uns stets durchaus untadelig, weise und heilig vor, wenn uns nicht handgreifliche Beweise unsere Ungerechtigkeit, Beflecktheit, Torheit und Unreinheit vor Augen halten und uns so überführen. Dazu kommt es aber gar nicht, wenn wir bloß auf uns selber sehen und nicht zugleich auf den Herrn; denn er ist doch die einzige Richtschnur, nach der solch ein Urteil über uns selbst erfolgen kann. Wir sind ja von Natur alle zur Heuchelei geneigt, und so befriedigt uns schon irgendein leerer Schein von Gerechtigkeit ebenso sehr, wie es die Gerechtigkeit selber nur könnte. Und weil unter uns und um uns rein nichts zu erblicken ist, das nicht mit schrecklichster Unreinheit befleckt wäre, so begeistert uns, solange wir über die Grenzen menschlicher Unreinheit nicht hinausblicken, schon das, was bloß ein bisschen weniger besudelt ist, weil wir es bereits für ganz rein halten. Es geht wie bei einem Auge, das ausschließlich an den Anblick schwarzer Farbe gewöhnt ist — und das dann schon für schneeweiß hält, was vielleicht grau oder geschwärztes Weiß ist. Überhaupt können wir uns an dem leiblichen Sinnesorgan — dem Auge — ein Beispiel nehmen, wie sehr wir in der Beurteilung unserer inneren Tüchtigkeit Trugbildern erliegen. Denn wenn wir am lichten Tage die Erde anschauen oder das, was uns umgibt, so wähnen wir wohl, ein starkes und durchdringendes Sehvermögen zu besitzen. Sobald wir aber die Sonne mit offenem Auge stracks anblicken wollen, so wird jene Sehkraft, die den Dingen dieser Erde gegenüber völlig ausreichte, ganz überwältigt und geblendet, so dass wir bekennen müssen, dass diese Sehkraft, so scharf sie im Irdischen war, gegen die Sonne geradezu Schwachsichtigkeit ist! Genau so ist es bei der Betrachtung unseres geistlichen Besitzes. Lenken wir den Blick nicht über die Erde hinaus, so sind wir mit der eigenen Gerechtigkeit, Weisheit und Tugend reichlich zufrieden und schmeicheln uns mächtig — es fehlte, dass wir uns für Halbgötter hielten! Aber wenn wir einmal anfangen, unsere Gedanken auf Gott emporzurichten, wenn wir bedenken, was er für ein Gott sei, wenn wir die strenge Vollkommenheit seiner Gerechtigkeit, Weisheit und Tugend erwägen, der wir doch gleichförmig sein sollten — so wird uns das, was uns zuvor unter dem trügerischen Gewand der Gerechtigkeit anglänzte, zur fürchterlichsten Ungerechtigkeit; was uns als Weisheit wundersam Eindruck machte, wird grausig als schlimmste Narrheit offenbar, was die Maske der Tugend an sich trug, wird als jämmerlichste Untüchtigkeit erfunden! So wenig kann vor Gottes Reinheit bestehen, was unter uns noch das Vollkommenste zu sein schien.
Daher kommt es, dass nach vielfach wiederholten Berichten der Schrift die Heiligen von Furcht und Entsetzen durchrüttelt und zu Boden geworfen wurden, sooft ihnen Gottes Gegenwart widerfuhr. Menschen., …
Weber, 1f
Text 4 – Die Kunst der Bibelauslegung
Das hebräische Wort Chazon wird zwar von Sehen abgeleitet und bedeutet eigentlich Gesicht, Vision; doch bezeichnet es gewissermaßen die Weissagung (Prophetie). Denn wo die Schrift besondere Gesichte erwähnt, die bei Propheten zwecks Vergewisserung vor Augen gestellt wurden, setzt sie als Bezeichnung Moreah. Um nicht der Zeugnisse mehr anzuführen: Wo im 1. Buche Samuel (Kap. 3) die Rebe ist von der Prophetie im allgemeinen, sagt der Verfasser des Buches, Gottes Wort sei teuer gewesen, weil wenig Chazon (Weissagung) im Lande war (1. Sam 3,1). Gleich darauf wird das Gesicht, wodurch sich Gott dem Samuel offenbarte, Moreah (Vision) genannt. Und Num. 12 (V. 6), wo Mose zwei ordentliche Arten von Offenbarung unterscheidet, verbindet er die Moreah besonders mit dem Traum. Doch geht aus Kapitel 9 (V. 9) des gleichen Samuelbuches hervor, daß den Propheten einst der Name Haroim (Seher, verwandt mit Moreah) beigelegt war, dies jedoch als Auszeichnung, weil Gott ihnen vertraulich seinen Ratschluß offenbarte. Was unsere Stelle nun betrifft, so wird mit diesem Wort (Chazon) zweifelsohne die Gewißheit der Lehre gekennzeichnet, als ob das heißen solle: in diesem Buche kommt nichts vor, was dem Jesaja nicht von Gott offenbart ist. Darum gilt es auf die Wortbedeutung zu achten, die uns lehrt, daß die Propheten nicht aus sich selber geredet und nicht ihre Hirngespinste ausgekramt haben, nein, erst wenn sie von Gott erleuchtet waren, haben sie ihre Augen aufgetan, um wahrzunehmen, was sie aus sich heraus sonst niemals hätten schauen können. So will uns denn die Überschrift Jesajas Botschaft anbefehlen als eine, die nicht menschliche Gedanken enthält, sondern Gottes Aussprüche.
Jesaja, 1. Hälfte, 15f
Text 5 – Über den Wert der Psalmen
Es geht darum, Lieder zu haben, die nicht nur anständig, sondern auch heilig sind; sie sollen für uns ein Ansporn sein, der uns zu Gebet und Gotteslob antreibt, zum Nachdenken über seine Werke, damit wir ihn lieben, fürchten, ehren und verherrlichen [ … ]. Darum mögen wir suchen, wo immer wir wollen: wir werden keine besseren Lieder finden als die Psalmen Davids [ … ]. Wenn wir sie singen, so sind wir sicher, dass Gott uns die Worte in den Mund legt, so als ob er selbst in uns sänge, um seine Ehre zu erhöhen.
CStA 2, 159
Text 6 – Psalm 46 (Deutsche Übersetzung eines französischen Textes Calvins)
1 Unser Gott ist uns fester Halt,
Stärke, Zuflucht und sicherer Trost;
bei ihm werden wir in unserem Verdruß
bereitstehende Zuflucht und sehr guten Hafen finden,
womit wir gewisse Zuversicht haben,
auch wenn wir sehen, wie die Erde
sich im Beben herabläßt
und wie sich Berge im Meer verbergen,
2 wenn das Meer lärmend und donnernd wie in Wut sich aufbläht,
die großen Felsen erschüttert und
sie mit den Wellen in Bewegung setzt.
Denn die Stadt, die Gott erwählt hat,
welche ihm als sein Ha us gefallen hat,
wird ihren sanften und lauteren Bach besitzen, welcher sie stets erfreuen wird.
3 Der Herr ist dort in der Mitte,
daher wird sie festbleiben,
um ihr jederzeit zu helfen,
wird er vom frühen Morgen über ihr wachen.
Die Völker sind in Aufruhr geraten,
Königreiche sind in Unruhe gekommen,
aber wenn Gott sie mit seiner Stimme schilt, werden sie augenblicklich alle ruhig.
4 Gott, der Führer der (himmlischen) Heerscharen,
der Gott Jakobs, ist mit uns;
so wird er unser Beschützer sein
gegen alle unsere Feinde.
So kommt und schauet,
jeder von euch befleißige sich zu sehen
die Wundertaten, die Gott vollbracht hat, als er seine Feinde besiegte.
5 Er ist es, der allein durch seinen Befehl
die ganze Erde zur Ruhe bringen kann
und auf der Welt alle Schlachten
ohne Widerspruch beendigen kann.
Er ist es, der die Wogen brechen,
Lanzen zersplittern kann;
mit Feuer verbrennt er
die Kampfwagen und vernichtet sie.
6 Darum läßt er alle wissen,
daß er es ist, der
um sein er großen Macht willen gefürchtet
und auf der ganzen Welt gepriesen werden muß.
Gott, der Lenker der (himmlischen) Heere,
wird uns immer als Beistand dienen,
der Gott Jakobs wird uns
als Zuflucht dienen
und uns behüten.
Jenny, 243ff
Text 7 – Calvin als Seelsorger / Aus einem Brief
Ich wollte, ich dürfte hier schließen, damit Du von mir nicht hören müßtest, was Dir, ich weiß es, schlimme Kunde sein wird. Aber ich zögere nicht, Dir zu sagen, was der Herr getan hat, Dir als einem Mann, der es gelernt hat, Gottes Vorsehung gerne zu gehorchen und es auch andere lehrt. Dein Neffe ist letzten Samstag von der Pest ergriffen worden. Sein Begleiter und ein Goldschmied, der seinerzeit in Lyon für das Evangelium Christi Zeugnis abgelegt hat, haben es mir gleich berichtet. Da ich eben zur Linderung meines Kopfwehs Pillen genommen, konnte ich nicht selbst hingehen. Aber alles, was zur körperlichen Pflege des Kranken nötig war, ist treulich und sorgfältig besorgt worden. Zur Pflege wurde eine Frau geholt, die beider Sprachen kundig war und früher schon Pestkranke gepflegt hatte. Sie nahm auch noch ihren Schwiegersohn zu Hilfe, da sie allein für die Arbeit nicht genügte. Grynäus hat ihn öfters besucht. Ich auch, sobald es mir meine eigene Gesundheit erlaubte. Als unser du Tailly sah, daß ich die Gefahr nicht fürchtete, wollte er sie mit mir teilen. Gestern waren wir lange bei ihm. Da schon sichere Anzeichen des kommenden Todes da waren, spendete ich ihm Trost mehr für die Seele als für den Leib. Er redete schon ein wenig irre, doch noch nicht sehr; denn er rief mich wieder in seine Kammer zurück und ersuchte mich, für ihn zu beten; er hatte mich nämlich von der Frucht des Gebets reden hören. Heute um die vierte Morgenstunde ging er zum Herrn ein. Über seinen Genossen, der an derselben Krankheit darniederliegt, können wir noch nichts Bestimmtes sagen. Gestern schien es mir, er trage Anzeichen an sich, die auf Besserung hoffen lassen; aber ich fürchte, diese Nacht könnte ihm geschadet haben. Denn wenn er auch in einer andern Schlafkammer lag und einen eigenen Wärter hatte, so konnte er doch alles hören, was seinem Freunde widerfuhr. Ich hoffe, ihn heute wiederzusehen.
Schwarz 1,80f
Text 8 – Prädestination
Der Glaube ist Resultat der Gnade Gottes (Von der ewigen Erwählung, 1551)
Dies nun muss unser Ausgangspunkt sein: Die Wurzel unseres Glaubens an Jesus Christus liegt nicht in unserem eigenen Bemühen, auch nicht darin, dass wir einen so hochfliegenden oder durchdringenden Geist hätten, um die im Evangelium enthaltene himmlische Weisheit zu erfassen. Sie entspringt vielmehr der Gnade Gottes, einer Gnade, die unsere Natur übersteigt. So bleibt nun zu prüfen, ob diese Gnade ein Gemeingut aller Menschen ist oder nicht. Die Heilige Schrift behauptet, dass dies nicht der Fall ist: Gott nämlich gibt seinen Heiligen Geist nach seinem eigenen Ermessen den Menschen, und er erleuchtet sie durch seinen Sohn. Das beweist die Erfahrung. Davon sind wir überzeugt. Daraus also muss man schließen, dass der Glaube aus einem weit höheren und verborgeneren Quellort und Ursprung hervorgeht: aus der Gnadenwahl Gottes, kraft der er nach seinem Wohlgefallen [Menschen] zum Heil erwählt.
Erwählung nach Epheser 1,3-14 (Von der ewigen Erwählung, 1551)
Genau das führt Paulus im ersten Kapitel des Epheserbriefes aus. Er preist Gott nicht nur über unserem Glauben oder richtiger darüber, dass er uns Jesus Christus gegeben hat, an den wir glauben sollen, weil in ihm die Erfüllung und Vollendung unseres Heils beschlossen liegt; er erklärt vielmehr: Gepriesen sei Gott, der uns berufen und erleuchtet hat, »wie er uns denn vor der Grundlegung der Welt erwählt hat« [Eph 1,4]. Jetzt also sehen wir, in welcher Weise Gottes Gnade in ihrer ganzen Fülle bei uns bekannt sein will: nicht nur, sofern wir von Herzen davon überzeugt sind, dass er uns den Glauben verliehen hat, sondern dass er ihn uns gerade deshalb verliehen hat, weil er uns vor der Erschaffung der Welt durch seinen Willen erwählt hat. Paulus begnügt sich indessen damit noch nicht, sondern fügt hinzu, dass uns Gott »nach dem freien Entschluss seines Willens« erwählt, »den er bei sich selbst zuvor gefasst hat« [V. 9]. Wir müssen diese Worte sorgfältig erwägen. […]
Paulus geht noch weiter. Er erklärt, dass Gott »uns in Jesus Christus erwählt« [V. 4] hat, und weist uns damit auf unsere eigene Unwürdigkeit hin. Das entspricht durchaus der Wahrheit, und die das bestreiten, missbrauchen ihre Überheblichkeit, indem sie in sich selbst etwas meinen vorweisen zu können, um dessentwillen Gott sie zu sich gerufen hätte. Deshalb fügt er hinzu, dass Gott uns »in seinem geliebten Sohn an Kindes statt angenommen« [V. 5] hat. Dabei schreibt er nicht ohne Grund unserm Herrn Jesus das Attribut des vielgeliebten Sohnes zu. Denn in uns selbst sind wir hassenswert, wert, dass Gott uns verabscheut; aber in seinem Sohn blickt er uns freundlich an, und daraufhin liebt er uns.
Lesebuch, 81ff
Text 9 – Ökumene
Wenn wir in den Glaubensartikeln bekennen, dass wir »die Kirche glauben«, so bezieht sich das nicht allein auf die sichtbare Kirche, von der wir jetzt reden, sondern auch auf alle Auserwählten Gottes, unter deren Zahl auch die einbegriffen werden, die bereits verstorben sind. Deshalb wird hier auch das Wörtlein »glauben« gebraucht; denn oft lässt sich kein Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den Unheiligen, zwischen seiner eigenen Herde und den wilden Tieren herausmerken. Manche fügen nun in das Glaubensbekenntnis das Wörtlein »an« ein: »Ich glaube an eine Kirche«; aber dafür besteht keine ersichtliche Ursache. Ich gebe allerdings zu, dass dies Verfahren recht gebräuchlich ist und auch des Beistandes der Alten Kirche nicht ermangelt. Denn auch das Nizänische Glaubensbekenntnis fügt in der Fassung, wie es uns die Kirchengeschichte überliefert, diese Präposition zu. Doch lässt sich zugleich aus den Schriften der Alten ersehen, dass es in alter Zeit ohne Widerrede üblich war, dass man sagte: »Ich glaube eine Kirche«, nicht aber: »Ich glaube an eine Kirche«. […]
In diesem Sinne müssen wir unser Augenmerk auf Gottes verborgene Erwählung und innerliche Berufung richten; denn er allein weiß, wer die Seinigen sind, und er hält sie, wie Paulus sagt, unter einem Siegel verschlossen (Eph 1,13; 11 Tim 2,19); dazu kommt auch, dass sie seine Kennzeichen tragen, an denen sie von den Verworfenen unterschieden werden sollen. Aber da das kleine, verachtete Häuflein unter einer unmessbaren Menge verborgen liegt und die wenigen Weizenkörner von einem Haufen von Spreu überdeckt werden, so muss man Gott allein die Erkenntnis seiner Kirche überlassen, deren Fundament ja seine verborgene Erwählung ist. Es ist aber nicht genug, dass wir solche Schar der Auserwählten bloß mit unserem Denken und unserem Herzen erfassen, sondern wir müssen dergestalt auf die Einheit der Kirche sinnen, dass wir wahrhaftig überzeugt sind, selbst in sie eingefügt zu sein. Denn wenn wir nicht mit allen übrigen Gliedern zusammen unter unserem Haupte, Christus, zu einer Einheit zusammengefügt sind, so bleibt uns keine Hoffnung auf das zukünftige Erbe. Deshalb heißt die Kirche »katholisch« oder »allgemein«; denn man könnte nicht zwei oder drei »Kirchen« finden, ohne dass damit Christus in Stücke gerissen würde — und das kann doch nicht geschehen! Nein, alle Auserwählten Gottes sind dergestalt in Christus miteinander verbunden, dass sie, wie sie ja an dem einen Haupte hängen, auch gleichsam zu einem Leibe zusammenwachsen, und sie leben in solcher Gefügtheit zusammen wie die Glieder des gleichen Leibes; sie sind wahrhaft eins geworden, als solche, die in einem Glauben, einer Hoffnung, einer Liebe, in dem gleichen Geiste Gottes miteinander leben und die nicht nur zum gleichen Erbe des ewigen Lebens berufen sind, sondern auch zum Teilhaben an dem einen Gott und dem einen Christus.
Weber, 683f
Text 10 – Abendgebet Calvins
Abendgebet. Herr, Gott, es hat dir bei der Schöpfung gefallen, die Nacht für die Ruhe des Menschen wie den Tag für seine Arbeit zu bestimmen. Darum wollest du mir die Gnade erweisen, in dieser Nacht den Leib so ruhen zu lassen, dass meine Seele immer zu dir wacht und mein Herz sich zu dir in Liebe erhebt. So möge ich mich von aller irdischen Sorge lösen und mich, wie es meiner Schwachheit Not tut, stärken, ohne dich zu vergessen. Lass aber die Erinnerung an deine Güte und Gnade immer in meinem Gedächtnis haften und gib damit meinem Gewissen ebenso seine geistliche Ruhe wie dem Leib die seine. Ferner möge mein Schlaf sich nicht über die Maßen ausdehnen, um sich der Bequemlichkeit meines Leibes in übertriebener Weise zu beugen, sondern sich nach der Gebrechlichkeit meiner Natur richten und nur solange dauern, dass ich wieder fähig bin, dir zu dienen. Auch möge es dir gefallen, mich an Leib und Seele unbefleckt zu erhalten und mich vor allen Gefahren zu bewahren, so dass selbst mein Schlaf deinen Namen verherrliche. Und da dieser Tag nicht vergangen ist, ohne dass ich armer Sünder dich vielfach erzürnt habe, wollest du, so wie jetzt die von dir auf die Erde gesandte Finsternis alles verbirgt, durch deine Barmherzigkeit auch alle meine Fehltritte begraben, damit du mich nicht um ihretwillen von deinem Angesicht verwirfst. Erhöre mich, mein Gott, mein Vater, mein Heiland, durch unseren Herrn Jesus Christus! Amen.
Genfer Katechismus, Anhang