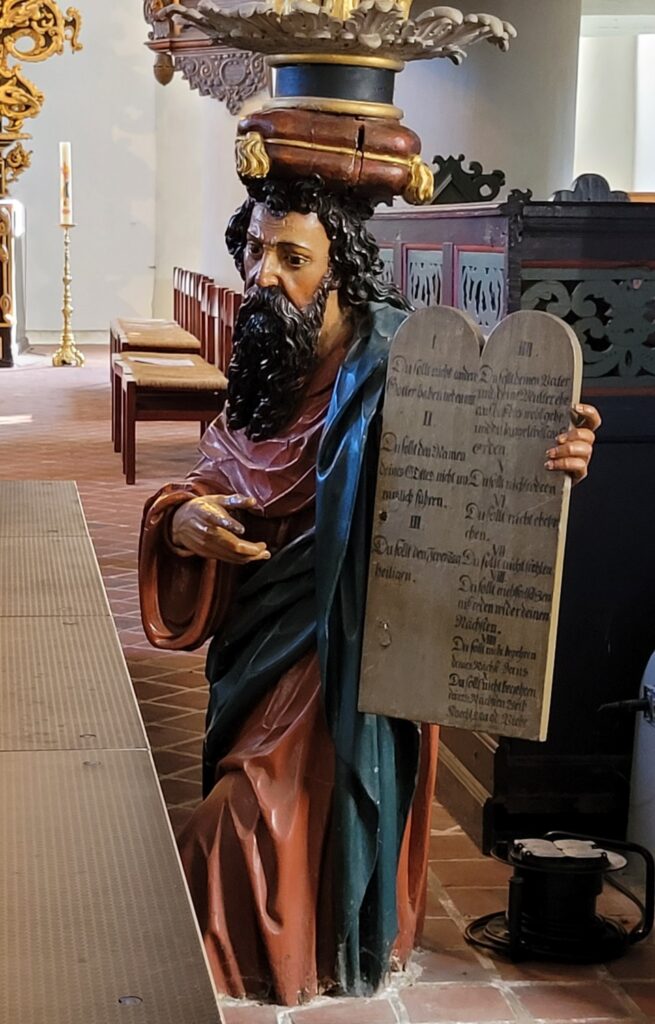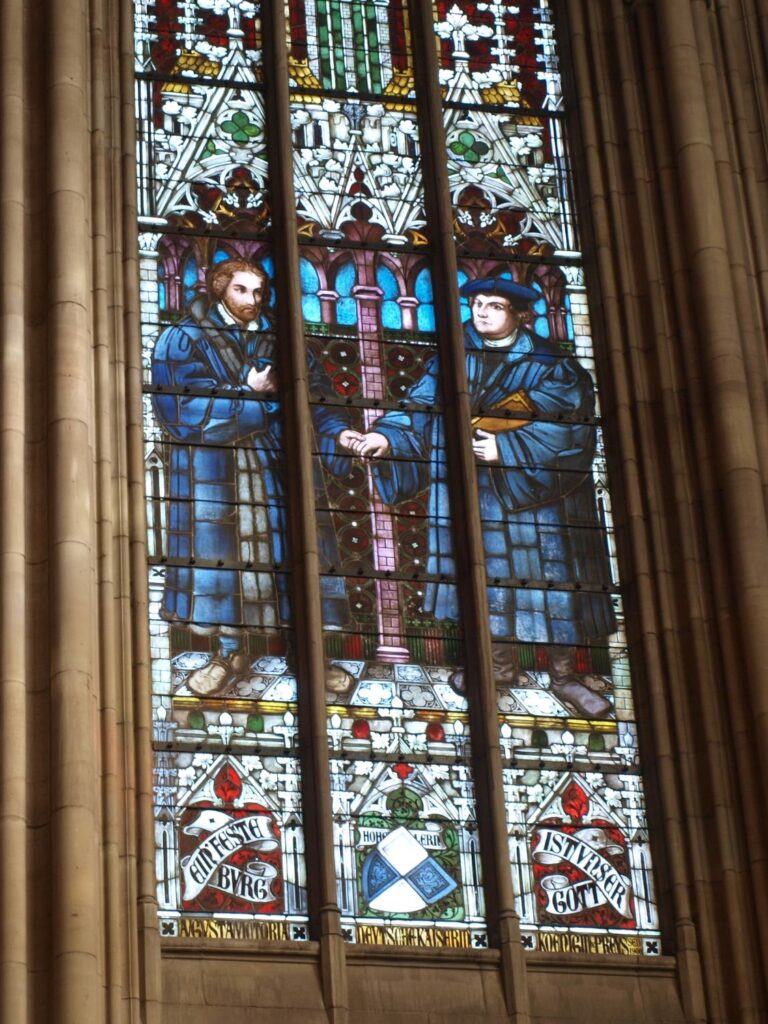Predigt
Ostern
„Die Grundbotschaft der ersten Christen“
1. Korinther 15,3b-5
Liebe Gemeinde,
Sie finden den für den heutigen Ostersonntag vorgeschlagenen Predigttext auf dem Beiblatt. Ich beschränke mich in meiner Predigt aber auf die Verse 3b-5. Es handelt sich bei diesen um ein ganz frühes fest formuliertes Bekenntnis der ersten Christenheit, das Paulus hier wiedergibt. (Man kann das an der Form und Formulierung erkennen (Parallelismus membrorum)).
Die „Urverkündigung“ hat sie einmal jemand genannt (Urkerygma). Wir sind mit diesen Versen bei den frühen Glaubensgeschwistern – höchstens 25 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Wir haben den Kern ihres Glaubens, das, was sie faszinierte, das, was ihnen am wichtigsten war, das, was sie liturgisch im Gottesdienst vortrugen (sie sitzen quasi mit uns hier in unserem Gottesdienst), ja das – und das ist das wichtigste -, was sie eigentlich zum Glauben brachte, vor Augen: Tod und Auferstehung Jesu! Karfreitag und Ostern!
Paulus erinnert auch uns an die Grundbotschaft wie seine damaligen Adressaten mit der Formulierung, die damals gebräuchlich war:
(Predigttext:)
Christus ist gestorben für unsre Sünden nach der Schrift;
4 und er ist begraben worden;
und er ist auferstanden am dritten Tage nach der Schrift;
5 und er ist gesehen worden von Kephas, danach von den Zwölfen.
Mit solchem Bekenntnis wurde als erstes christliches Fest schon früh natürlich Ostern gefeiert. Da dachte man an Weihnachten noch gar nicht. Und so wurde der Sabbat später für Christen zum Sonntag, dem „Herrentag“, dem ersten Tag der Woche, dem Auferstehungstag.
Karfreitag und Ostern, diese elementarsten Glaubensinhalte durchziehen die gesamte Kirchengeschichte wie ein roter Faden,
sicherlich vielfach angereichert und aufgefüllt und ergänzt, durch menschliche Erkenntnis erweitert – doch immer wieder auf den Punkt gebracht.
Allem Zeitgeist und aller Überfremdung und Versuchen der Überfremdung haben sie getrotzt und widerstanden. Wir spüren, wie wichtig es ist, sich immer wieder auf den Grund der Bibel zu besinnen, dass Gottes Geist sich entfalten kann und wir die Botschaft mit dem Herzen hören: Karfreitag und Ostern! –
Es wird heute mit diesen Versen sehr Grundsätzliches zu sagen sein. Ich meine, dass die frohe Botschaft dieses Predigtabschnittes ein vierfach Grundsätzliches ist.
1
Mit dem Ausdruck „nach der Schrift“ will ich anfangen. Die ersten Christen – und auch viele nach ihnen – haben eigentlich immer im Christusgeschehen die Schrift, also was wir als das Alte Testament bezeichnen, bestätigt gesehen. Was in diesem angekündigt wird, erfüllt sich in Christus.
Damit kommt etwas zur Sprache, was in heutigen Predigten selten zu hören ist, nämlich, dass es zum grundlegenden Glauben von Christen gehört, in der Zeit eine Entwicklung zu sehen. Die Worte „nach der Schrift“ deuten darauf hin. Sowohl Tod als auch Auferstehung Jesu werden als in den Schriften vorhergesehen angesehen, als vorher gesagt erkannt. Jesaja 53 etwa: Karfreitag: „Fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen.“ Und Ostern: „Er ist aus Angst und Gericht hinweg genommen.“ Das erklärt der Apostel Philippus dem Schatzmeister der äthiopischen Königin, der fragt ihn ja: „Von wem schreibt der Prophet das?“ Antwort: „Von Christus!“
Und das Verständnis der alten Schriften ging noch weiter. Die Geschichte mit dem Volk Israel, so entdeckte man, ist keine zufällige, sondern aus diesem Volk soll der kommen, der Israel erlösen wird. Und das Heil kommt von den Juden, wussten sie. (Johannes 4,22)
Es gibt also eine Geschichte in der menschlichen, in der Weltgeschichte. Sie läuft auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi zu. Er ist die „Mitte der Zeit“ (G. Conzelmann). Und die Geschichte Jesu Christi setzt sich auch weiter fort – bis hin zu uns und über uns hinaus …
Was ist darin für uns die frohe Botschaft, das Evangelium?
Ich will es so sagen: Je älter wir werden, erkennen wir, das die Geschichte der Menschheit unverfügbar ist. Entwicklungen mögen ein Stück weit vorhersehbar sein, auch gestaltbar. Wir mögen auch Ursachen benennen können, warum es unter uns so zugeht, wie es zugeht – oder bei anderen oder im Zusammenspiel der Völker. Wer aber Menschen hört, die das ganze 20. Jahrhundert miterlebt haben –alle Tiefen (Krieg, Hunger, den Zusammenbruch), alle Höhen (Aufstieg, unabsehbar und z.T. unvorstellbaren Reichtum nach wenigen Jahrzehnten), wer darüber hinaus sieht, dass es bei anderen Völkern ebenso Auf- und Abstieg gibt, bis dahin, dass sie ganz von der Bildfläche verschwinden, wer die Reiche der Antike sieht oder die der Indigenen Völker, der kann nur zu dem Schluss kommen: Letztlich ist alle Geschichte, so sehr wir auch im Kleinen wie im Großen versuchen, an den Rädchen zu drehen, unverfügbar und die Menschen schwimmen in den Strömen der Zeit mit.
Die erste frohe Botschaft, die ich von diesem Predigtabschnitt her heute „verkündige“: Wir sind nicht Menschen, die in den Weiten und Unbillen der irdischen Geschichte verloren unser Leben fristen, sondern wir wissen von einer Welt, die sich verändert hat, und die Gott wann auch immer vollenden wird.
Als solche dürfen wir uns erkennen und verstehen, die wir in Ostern das entscheidende Ereignis der sich erfüllenden Geschichte sehen. Gottes erschienene Liebe und das von Jesus Christus erworbene Leben zeitigt Folgen.
2
Die zweite frohe Botschaft steckt in den Worten „für unsere Sünden gestorben“. Heute am Ostertag muss nun nicht das Karfreitagsevangelium wiederholt werden, also dass Jesus Christus unsere Schuld, das was uns belastet vor Gott, auf sich genommen und sich für uns aufgeopfert hat.
Vielmehr heute am Ostertag ist zu sagen: In Jesu Auferstehung ist zu erkennen, dass sein Tod tatsächlich Sinn macht und ein Geschehen für uns ist. Von uns aus können wir das Dunkel des Karfreitags nicht durchdringen. Die Betrachtung des Leidens Christi weist ohne den Auferstandenen, ohne den uns ins Herz gegeben Glauben an den Auferstandenen, allenfalls die Sinnlosigkeit des Lebens Jesu und den Sieg des Todes. Wir können dann nur das Schreckliche in seinem Tod sehen.
Erinnern sie sich z.B. an die Diskussionen um die Kruzifixe in Schulen? Sie wollte man aus den Klassenzimmern verbannen, weil man das Schreckliche den Schülern nicht zumuten könne. Oder erinnern sie sich an den Film über Jesus von MelGibson? Der Tod Jesu wurde da in besonders realistisch-grausamer Weise dargestellt, sozusagen als Beweis seines göttlichen Todes. Der Film ist genau im Gegenteil ein Beweis, dass wir das Wichtigste versäumen, wenn wir nur sehen, was vor Augen ist. Der gekreuzigte Christus wird nie populär sein; schon seine Jünger verließen ihn am Karfreitag.
Doch Gott gibt diesem Geschehen von Karfreitag Recht. Er gibt Jesus und seinem Tun Recht, indem er ihn auferweckt, ihn nicht im Tod bleiben lässt und schenkt uns den Glauben, dieses erkennen zu können.
Darum können wir in Jes 53 einstimmen: „Fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen und unsere Schuld!“ Dieses Bibelwort haben Philippus, der Schatzmeister der äthiopischen Königin und viele nach ihnen bis zu uns erst im Glauben an den Auferstandenen verstehen können: er, dieser Auferstandene ist es gewesen, von dem hier gesprochen wird.
3
Der dritte grundsätzliche Glaubenssatz der ersten Christen ist in dem Wort „auferstanden“ zu sehen.
Zum Glauben an die Sündenvergebung kommt der Glaube an die Auferstehung als Essential des Glaubens.
Der 1. Korintherbrief zeigt nun, dass die Menschen in Korinth mit der Auferstehung Jesu Christi kein Glaubensproblem hatten. Sie war selbstverständliches Glaubensgut. So wie es bei uns Christen und Christinnen glauben und Nichtchristen den Christen dies unterstellen, dass sie das glauben.
Aber dass der erste Ostermorgen die Konsequenz für sie haben könnte, auch selbst im Tod von Gott angenommen zu werden, war für viele in der Gemeinde zu Korinth schwer anzunehmen. Paulus versucht sie hier leidenschaftlich davon zu überzeugen.
V. 12: „Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist (wie Ihr ja auch glaubt), wie können da einige unter Euch sagen es gibt keine Auferstehung der Toten?“
V. 19: „Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir de Elendsten unter allen Menschen!“ –
Wie sieht es bei uns mit dem Glauben an die Auferstehung von den Toten aus?
Nach einer Umfrage glauben in Deutschland 31 % der Menschen ganz sicher an die Auferstehung der Toten und immerhin 47 % halten sie für möglich! Das finde ich einen erstaunlich hohen Prozentsatz in einer vom rationalen Denken bestimmten Zeit. Das heißt ja, dass nur 22 Prozent, na sagen wir nur jeder fünfte eine solche Vorstellung ablehnt!
Die Zahlen sind aber nicht so wichtig. Mir begegnen Menschen mit ganz verschiedenen Vorstellungen vom Tod und vom Leben nach dem Tod.
Eine Reihe hoffen darauf und sie stellen sich vor, dass sie geliebte Menschen, den Ehepartner z.B., wiedersehen werden. Oder sie sagen: „Jetzt ist die Oma wieder bei unserem Opa.“
Manche sehnen sich nach dem Himmel; sie fühlen sich geborgen. Sie kennen die Worte der Bibel von der „himmlischen Heimat“.
Und für manche ist diese Vorstellung auch das ersehnte Ende eines schrecklichen Leidens.
Erstaunlicherweise gibt es auch unter Christen immer wieder mal die Vorstellung der Wiedergeburt auf Erden in einem weiteren Leben.
Hinzufügen möchte ich auch, dass es nicht wenige Menschen gibt, die gar nicht auferstehen wollen, die sich gar nicht in einem Leben hinter der Grenze des Todes wieder finden wollen.
[Von den Gleichgültigen will ich jetzt einmal ganz absehen.]
In diese unterschiedlichen Vorstellungen hinein wird uns an diesem Osterfest in Erinnerung gerufen und allen Menschen zum Trost und zur Hoffnung gesagt: „Jesus Christus ist auferstanden und das gibt uns die Gewähr dafür, dass auch die übrigen Toten auferstehen werden.“ (Übersetzung nach der „Guten Nachricht“)
Ostern, die Auferweckung Jesus Christi vom Tod, bedeutet den Neuanfang für uns Menschen und für die Welt und eben auch für die bereits Verstorbenen. Unsere Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind, wir selbst, liegen Gott am Herzen und er hat den Weg eröffnet, dass sie / dass wir nicht einfach vergangen und gewesen sind, sondern Zukunft in seiner Geborgenheit ohne Leid und Streit ohne Tränen finden.
Ostern! Angesichts dieses Neuanfangs können wir eigentlich gar nicht mehr anders als so vom Tod reden, dass wir sogleich auch von der Auferstehung der Toten sprechen.
Und deshalb können wir auch leben als Menschen, für die die Sinngebung ihres Daseins im Tod keine letzte Grenze findet.
Wir können leben als Menschen, für die die Entschlafenen nicht einfach vergangen sind und das Gedenken an sie nicht nur pietätvolle und sentimentale Erinnerung ist, sondern ein Gefühl bleibender Gegenwart. –
4
Und noch der vierte grundsätzliche Glaubensinhalt der „Urverkündigung“: „Er ist gesehen worden von Kephas, danach von den Zwölfen.“
Paulus geht noch über diese formelhafte Feststellung hinaus. Er nennt auch mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal und Jakobus, danach von allen Aposteln, ja sich selbst.
Zumindest Paulus selbst hat den Auferstandenen nicht mit seinen Augen, nicht optisch gesehen. Von den Aposteln erfahren wir da in den Evangelien schon eher etwas. Wer die Fünfhundert waren, wissen wir nicht.
Spürbar wird, dass Paulus nicht von den Auferstehungszeugen in einem historischen Sinn spricht, sondern davon, dass er die Gemeindeglieder in Korinth, noch allgemeiner: die Christinnen und Christen – und dann sind auch wir dabei – als Auferstehungszeugen ansieht, als die, die an den Auferstandenen glauben und mit ihrem Glauben diese Wahrheit bezeugen. Ich finde, dass Paulus damit so etwas wie eine erste Beschreibung davon gibt, was ein Christ ist: nämlich ein „Auferstehungszeuge“. Einer der vom Lebenssieg Jesus Christi etwas weiß. Wir sind Auferstehungszeugen nicht, weil wir dabei gewesen sind, sondern weil die Auferstehung an uns wirksam ist!
(Dieser Abschnitt in Anlehnung an „Werkstatt für …“) Dass wir zweifelhafte Zeugen sind, das wissen wir [wohl] selbst. Das wusste Paulus auch von sich. Auch sind wir bereit, Christus zu verleugnen wie Petrus, als uns zu ihm zu bekennen. Wie oft schlagen wir die frohe Botschaft in den Wind und glauben windigen Fakten und Wahrheiten. Wir sind Zeugen der Auferstehung, so zweifelhaft, aber auch so glaubwürdig, wie Paulus und Petrus es waren. Und wir berufen uns dabei auf die, die es uns seit der Zeit der Apostel weiter erzählt haben, die selbst Zeugen waren: Eltern, Lehrer/Lehrerinnen, Pfarrer/Pfarrerinnen, Kindergottesdienstmitarbeiter/Kindergottesdienstmitarbeiterinnen, Freunde und vielleicht Fremde, allesamt Zeugen und Zeuginnen der Auferstehung. Paulus beruft sich dabei auf das, was wir heute Tradition, Geschichte nennen. Wir können auch heute nur glauben, weil wir ebenfalls in diesem Zusammenhang stehen. Ohne Tradition und Geschichte des Christentums … gibt es keine Verkündigung. … Es gehört wohl zu den erstaunlichsten Dingen in der Bibel, dass sich … der auferstandene Christus in die Hand, besser in den Mund von uns Menschen gibt. Der Auferstandene gibt sich in den Mund der ersten Zeugen bis heute. Niemand wird durch einen Beweis überwältigt, niemand durch eine schlagfertige Diskussion überzeugt, niemand muss allein dem Zeugnis des Neuen Testamentes vertrauen. Aber durch den Mund von Zeugen, durch ihre Verkündigung, durch ihr verändertes und in Bewegung geratenes Leben will der Auferstandene Glauben wecken, … . Es gibt nur eine Möglichkeit das Ereignis von Ostern zu verstehen: dass wir es uns immer wieder sagen lassen, hören, erstaunt, verwundert, und dass wir davon reden, von unserem Staunen und unserer Verwunderung – und zwar öffentlich. Dieses „Predigtamt“ haben wie nach dem Augsburger Bekenntnis und der Barmer Theologischen Erklärung alle (ministerium ecclesiasticum). Es ist nicht nur die Aufgabe der Dienerinnen und Diener am Wort.
Also lasst uns hinausgehen aus diesem Osterfest mit der vielfältigen frohen Botschaft und sie weitergeben, dass
• wir in dieser Weltengeschichte getragen und geführt werden,
• dass Gott unsere Fehler nicht zugerechnet hat,
• dass wir eine echte Hoffnung auf ein neues Leben hinter der Grenze des Todes haben
• und dass wir all das Gute, was wir glauben dürfen, nicht für uns behalten, sondern in Worten und Tun weitergeben und anderen Glauben ermöglichen.
Mit solchem Glauben sind wir verbunden über die Jahrhunderte hinweg mit den frühen Christinnen und Christen und den Aposteln.
Amen.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.