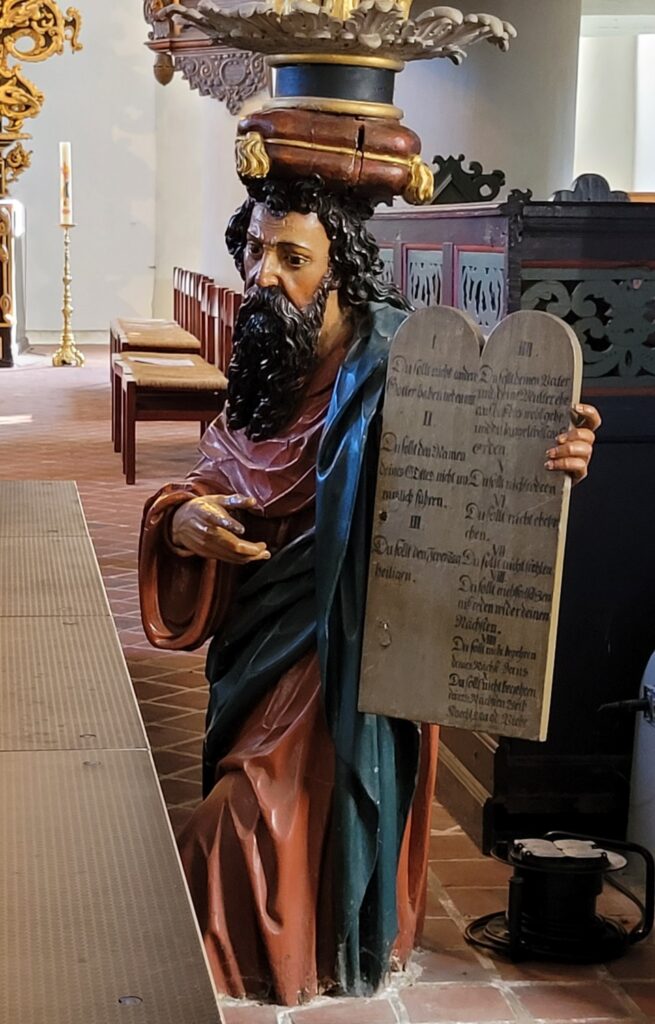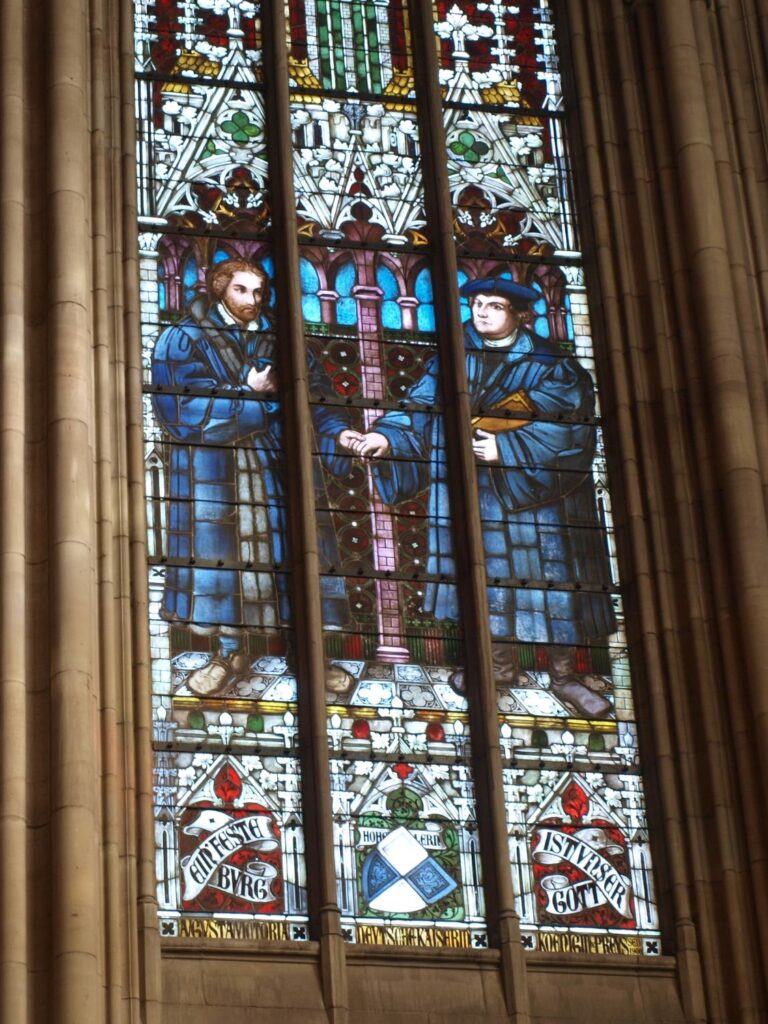„Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen“
(Hg. von der Evangelischen Kirche im Rheinland, Düsseldorf 2015)
– Eine Zusammenfassung –
Im September 2015 wurde auf Beschluss der Kirchenleitung die Handreichung „Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen“ den Ämtern, Werken und Einrichtungen der Ev. Kirche im Rheinland zugestellt.
Bisherige inhaltliche Arbeit der Rheinischen Kirche im Blick auf den Islam anhand der bis dahin erschienenen Schriften:
• „Christen und Muslime nebeneinander vor dem einen Gott. Zur Frage gemeinsamen Betens (1997 / überarbeitete Auflage 1998)
• „Erste Schritte wagen: Eine Orientierungshilfe für die Begegnung von Kirchengemeinden mit ihren muslimischen Nachbarn“ (2001)
• „Dialog und Mission in der Begegnung mit Muslimen“ (2001),
• „Abraham und der Glaube an den einen Gott (2009),
• „Religionsfreiheit gestalten“ (2012)
Inhaltsangabe „Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen“
In einem Vorwort weist Präses Rekowski auf die Veränderungen im Zusammenleben mit Muslimen hin (Selbstverständlichkeit des Zusammenlebens; Auseinandersetzungen, Radikalisierungen), die die Handreichung erforderlich gemacht hätten. Die Handreichung wolle zu weiterer Öffnung, zur Auseinandersetzung mit den Begriffen „Dialog“ und „Mission“ beitragen und zur vertieften Diskussion anregen.
Die Einleitung (S.5-7) beschreibt die zunehmende Heterogenität der Gesellschaft in der Alltagswelt im letzten halben Jahrhundert, macht auf sich wandelnde Begrifflichkeiten aufmerksam (alt: „Ausländerpädagogik“, „multikulturelle Gesellschaft“ u.a.; neu: „interkulturelle Gesellschaft“, „interreligiöses Lernen“, „soziale Inklusion“ u.a.), woraus die Frage nach „Dialog“ und „Mission“ im Blick auf Muslime neu gestellt werden müsse.
Die Handreichung greife auf die Handreichung „Dialog und Mission in der Begegnung mit Muslimen“ (2001) zurück, wobei der damalige „Kuscheldialog“ vermieden werden solle und die parallelen Glaubensüberlieferungen Anknüpfungspunkte sein könnten.
Die soziale Arbeit in Bildungseinrichtungen, Verwaltungs- und politischen Gremien erfordere eine interkulturelle Öffnung.
Durch den Begriff Inklusion sei der Perspektivwechsel weg von der Betonung der Unterschiede hin zum Verbindenden und Gemeinsamen deutlich. Kirchengemeinden, diakonische Einrichtungen und der christlich-muslimische Dialog sollen beitragen, dass Ausgrenzungen (verbal, politisch, ökologisch) überwunden werden.
Die Handreichung verstehe sich als Frage nach den Möglichkeiten und Anknüpfungspunkten für ein interreligiöses Miteinander und als „einladend ausgestreckte Hand“.
Die Gliederung der Broschüre wird beschrieben.
Unter 2 wird der Frage „Was ist Dialog?“ nachgegangen (S.8-13).
Biblisch-theologische Erwägungen zeigten, dass der Gedanke der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen und das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe die Haltung des Respektes und der Wertschätzung im Dialog begründen.
Die Hebräische Bibel berichte zu Beginn über die gemeinsame Urgeschichte und die Zusagen des Noahbundes an alle Menschen. Mit Abraham setze die Erwählungsgeschichte ein, deren Verheißung auch allen Völkern gelte. In der Exilszeit trete „der Glaube an den Schöpfer, auch den Schöpfer der vielen Völker“ in den Vordergrund. Die Bedrohung der eigenen Existenz führe aber auch zu abgrenzenden Traditionen, die allein in ihrem Kontext zu verstehen seien. Auch Fremde schlössen sich der Verehrung Jahwes an. Nichtisraelitischen Frauen erhielten eine zentrale Rolle in der Geschichte Gottes mit den Menschen (Hagar, Ruth, Rahab, Batseba). Hagars Sohn Ismael erhalte Gottes Segen. „Menschen aus allen Völkern gilt Gottes Segen“. Die „Völkerwallfahrt zum Zion“ verweise auf den „Heilswillen Gottes für alle Geschöpfe“.
Im Neuen Testament weisen viele Begebenheiten darauf hin, dass „Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die er seinem Volk zugesprochen hat, … von Beginn an nicht nur auf Israel beschränkt [ist], sondern … auf das Heil aller Menschen [zielt].“ (S.11)
„In gleicher Weise ist es an uns Christen zu fragen, ob die Offenbarung in Jesus Christus notwendig bedeutet, dass Gott eine Beziehung zu Menschen aller anderen Religionen an ein ausdrückliches Bekenntnis zu Christus bindet.“ (S.11) Es sei „mit der Möglichkeit von Wahrheitsansprüchen in den anderen Religionen zu rechnen, die dem christlichen Glauben widersprechen und auch solche außerhalb religiöser Gemeinschaften ihre Berechtigung haben können.“ (S.12)
Es wird hingewiesen auf das besondere Verhältnis der „abrahamitischen“ Religionen, die den Dialog mit Muslimen im Verhältnis zu anderen Religionen „in einen besonderen Kontext“ setze. Dazu komme die Anerkennung Jesu als Prophet im Islam.
Unter 3 wird die Frage gestellt „Wie verhält sich Mission zum Dialog?“ (S.13-17)
Es wird der Begriff missio dei anhand der biblischen Überlieferung entfaltet. Es zeige sich Gottes umfassender Heilswillen für seine Menschen, wobei „Menschen zu eigenem Urteilen und eigener Stellungnahme aufgefordert“ werden (S.13). Und „es wird niemand gegen seinen Willen geheilt oder manipuliert.“(S.14) „Jesus zu folgen heißt, nach dem Reich Gottes zu trachten und auf die Liebe Gottes zu allen Menschen zu vertrauen.“ (S.14) So verstehe sich die Rheinische Landeskirche als „Missionarische Volkskirche“, indem sie teilnimmt „an Gottes Bewegung hin zu seinem Reich der Gerechtigkeit, Befreiung und Versöhnung. Mit Israel hofft sie auf einen neuen Himmel und eine neue Erde.“ (LS 14.01.2010)
Der missio dei stünden Missionskonzepte von Evangelisation und persönlicher Bekehrung entgegen, die sich auf das im 19. Jahrhundert entstandene Verständnis von Mt 28 als „Missionsbefehl“ berufen. „Die Bewegung hin zu den Völkern hat im Kontext des MT-Evangeliums … weniger den Charakter des Befehls, die Welt zu missionieren und alle zu Christen zu machen, vielmehr geht es um die explizite Erlaubnis, die gute Botschaft auch unter den Völkern bekannt machen zu dürfen.“ (S.15) Nicht das grundsätzliche Ziel der Bekehrung, sondern im Handeln Zeugnis abzulegen, was den Glauben trägt, sei erforderlich. Heute sei eher zu fragen, die eigene Praxis darauf hin zu befragen, ob sie der Verkündigung des Reiches Gottes gerecht wird. (S.16)
Die Differenz des Bekenntnisses zu Jesus Christus zum Islam „muss ausgehalten werden“. (S.16)
Zudem sei zu fragen, was Christen in der missio dei von Muslimen zu lernen haben. (S.17). Ein „Dialog des Lebens“ sei anzustreben.
Unter 4 werden „Dialog und Mission im ökumenischen Kontext“ beschrieben. (S.17-22)
Es wird verwiesen auf die Schrift der ÖRK „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt – Empfehlungen für einen Verhaltenskodex“, den auch der Päpstliche Rat für den Interreligiösen Dialog und die weltweite Evangelische Allianz unterzeichnet hat, die zu Liebe und Respekt und zu wechselseitigem vertieften Verständnis aufruft. (S.18) Das Beispiel einer „Interreligiösen Tafelrunde“ aus Indonesien zeige Möglichkeiten des Dialogs unter schwierigen Bedingungen. (S.19-21) Fundamentalistische Verweigerungen des Dialogs erkennen nicht die Fehlbarkeit und Grenzen des Erkenntnisvermögens von Menschen und erhebt den Menschen selbst zum letzten Maßstab. (S.22) Demut sei die Grundhaltung des Dialogs.
Unter 5 werden „Folgerungen für Kirche und Gemeinde“ gezogen. (S.23-30)
Es wird im Blick auf den Alltag in den Einrichtungen die Notwendigkeit von konstruktiver Zusammenarbeit (Dialog des Lebens) und „interkultureller Kompetenz“ betont. (S.23) Aufgrund der Religionsfreiheit und des Subsidiaritätsprinzips ist eine Beteiligung von Muslimen mit gleichen Rechten und Pflichten in Deutschland zu fordern. Der demokratische Rechtsstaat könne die menschenrechtlich verankerte Religionsfreiheit nicht erlauben oder verwehren, sondern habe sie zu schützen. (S.24) Religionsfreiheit könne mit anderen Grundrechten in Konflikt geraten (z.B. Beschneidungsdebatte 2012). Die Freiheit zum Religionswechsel müsse gegeben sein, wozu sich entgegen sonstiger muslimischer Praxis die Islamische Charta 2002 ausgesprochen hat. Die Forderung nach Religionsfreiheit für Christen in muslimischen Ländern beinhalte die Einhaltung der Standards der eigenen Praxis. (S.26) Die EKiR habe sich wiederholt für islamischen Unterricht an den Schulen ausgesprochen, der auch Chance für christliche Schüler sei, Muslime „in ihrer religiösen Dimension“ wahrzunehmen. (S.27) In evangelischen Bekenntnisschulen und Berufskollegs nähmen muslimische Schüler in der Regel am evangelischen Religionsunterricht teil, was die Chancen des Dialogs erhöhe. Ein islamischer Religionsunterricht würde hier die Bekenntnisbildung der evangelischen Schüler erhöhen. (S.27) „Liturgische Gastfreundschaft“ lasse muslimische Kinder, die einen solchen Gottesdienst in ihrer Religion nicht kennen, an evangelischen Schulgottesdiensten teilnehmen; dabei sei auf Sensibilität zu achten. Schulentlassfeiern seien als multireligiöse Schulfeiern durchzuführen. (S.28) Unauflösbare Widersprüche regten zum Fragen an (trinitarisches Gottesverständnis, Mohammed als „Siegel der Propheten“, Jesus als Erlöser). (S. 28f) Mit der Etablierung des Fachs Islamische Theologie an deutschen Hochschulen wird die Hoffnung auf einen wissenschaftlichen Dialog verbunden. (S.30)
Unter 6 wird ein „Blick in die Zukunft: Weggemeinschaft“ geworfen. (S.30-31)
Der Glaube in seiner jeweils eigenen Gestalt führe aus Angst und Resignation und mache handlungsfähig und lasse Zeugnis ablegen als Teil der missio dei. Muslime seien „auf diesem Weg an unserer Seite“, für deren Gleichstellung sich Christen einsetzen sollen. (S.30) Andere Bündnispartner seien für die Arbeit vor Ort wichtig. Bündnisse und Kooperationen seien notwendig, nicht eine „Wagenburgmentaltität“. Religionsgemeinschaften könnten den Ort für die notwendigen Debatten zu Orientierungsfragen stellen. „Dabei kann das Bild der Hilfsgemeinschaft, der Lerngemeinschaft und der Festgemeinschaft eine Orientierung für die Verwirklichung einer Konvivenz von Christen und Muslimen an den je unterschiedlichen Orten der Begegnung sein.“ Und im gemeinsames Hören auf die Worte der uns gegeben Schriften fänden wir Wegweisung. (S.31)
Auf S. 32 folgt noch der Fragenkatalog „Fragen zur Weiterarbeit“.